Inhalt
Editorial
Mona Körte
Unverhohlen – Zu einer philologischen Liaison von Sprache und Rache
Roman Widder
Unversöhnlichkeit, Ressentiment und Verneinungswahn
Julia Boog-Kaminski
Freud Through The Looking-Glass, Formen des Unsinns
Regina Karl
Un, der Vampir – Versuch einer Analogie
Karl-Josef Pazzini
Nähe als Unfall
Artur R. Boelderl
UNgelesen es: les lUNettes
Leon S. Brenner
»Morgen werde ich gekommen sein« – Die harte Realität der menschlichen Sexualfunktion
Viktor Mazin
Keine Entlastung und Befriedigung, aber jouissance
Camilla Croce
Jouissance des Stilllebens
Karl-Josef Pazzini
Trennung, Trauer, Lesenlernen
QRT
Extase der privaten Deprivation
Greg Tuck
Masturbation, Masturbationswaren und die Logik des Marktes
Insa Härtel
Mediale Selbst-Stimulation – Exhibierte Griffe in Schritte
Silvia Lippi
Die Schicksale der Masturbation
Einsatz
Karl-Josef Pazzini
2023-05-06 Ukraine Gefühle Hornhaut
Rezensionen
Hermanns, Ludger M.; Bouville, Valérie; Wagner, Cornelia (Hg.), Ein Jahrhundert psychoanalytische Ausbildung. Einblicke in internationale Entwicklungen. Gießen 2021, Psychosozial-Verlag, rezensiert von Karl-Josef Pazzini
Psychoanalyse & Ausbildung? Notizen zu einer Dokumentation
Es sollte eine einfache Rezension werden. Dann hat die Lektüre des Buches Fragen auftauchen lassen, die mit der eigenen Ausbildung zu tun hatten und haben und die grundsätzlich das Konzept Ausbildung wieder zum Problem gemacht. Stärker denn je brachte die Lektüre all dies in Zusammenhang mit der Geschichte der Psychoanalyse insbesondere in Deutschland, mit der Anfälligkeit der Psychoanalyse für politische Anpassung. Der Diskurs der Psychoanalyse, auch geschichtlich betrachtet und verstanden als soziales Band[2], zeigt symptomatisch heftigen, oft um Formalia tobenden Streit, Spaltung, Verrenkung und Ausschluss und legt nahe, dass der im vorliegenden Buch unreflektiert weitergeschriebene Begriff der Ausbildung mit der psychoanalytischen Erfahrung nicht problemlos kompatibel ist. In den Auseinandersetzungen, die an verschiedenen Stellen in der Dokumentation erwähnt werden, geht es offenbar nicht nur um die Ausgestaltung der Ausbildung, sondern um die Frage, ob Psychoanalyse nicht eine Neuerfindung, eine weitgehende Übersetzung dessen braucht, was in anderen Diskursen und deren Institutionen als Ausbildung bezeichnet und als möglich behauptet wird. Perspektivisch, hier nicht verhandelt, könnte stärker daran gearbeitet werden, wie andere Diskurse und deren Institutionen, etwa Universitäten, auf der Basis der Erfahrungen und der Kenntnisse aus der Psychoanalyse von der Psychoanalyse profitieren können.
Eher in Nebenbemerkungen wird die vorliegende Dokumentation zur Anregung für Neuerfindung und Fortsetzbarkeit der Psychoanalyse. Weder ein einzelner Kongress noch seine Dokumentation kann der komplexen Frage der Bildung des Analytikers gerecht werden. Mehr erwartet hätte der Rezensent an Analyse von Zusammenhängen zwischen der so genannten Ausbildung, Versagen, Fehlentwicklungen und Kompromissbildungen. Aber das Buch hat den Vorteil, deutlich zu machen, wo ungeklärte Probleme liegen, auch wenn man dazu bei der Lektüre etwas graben muss.
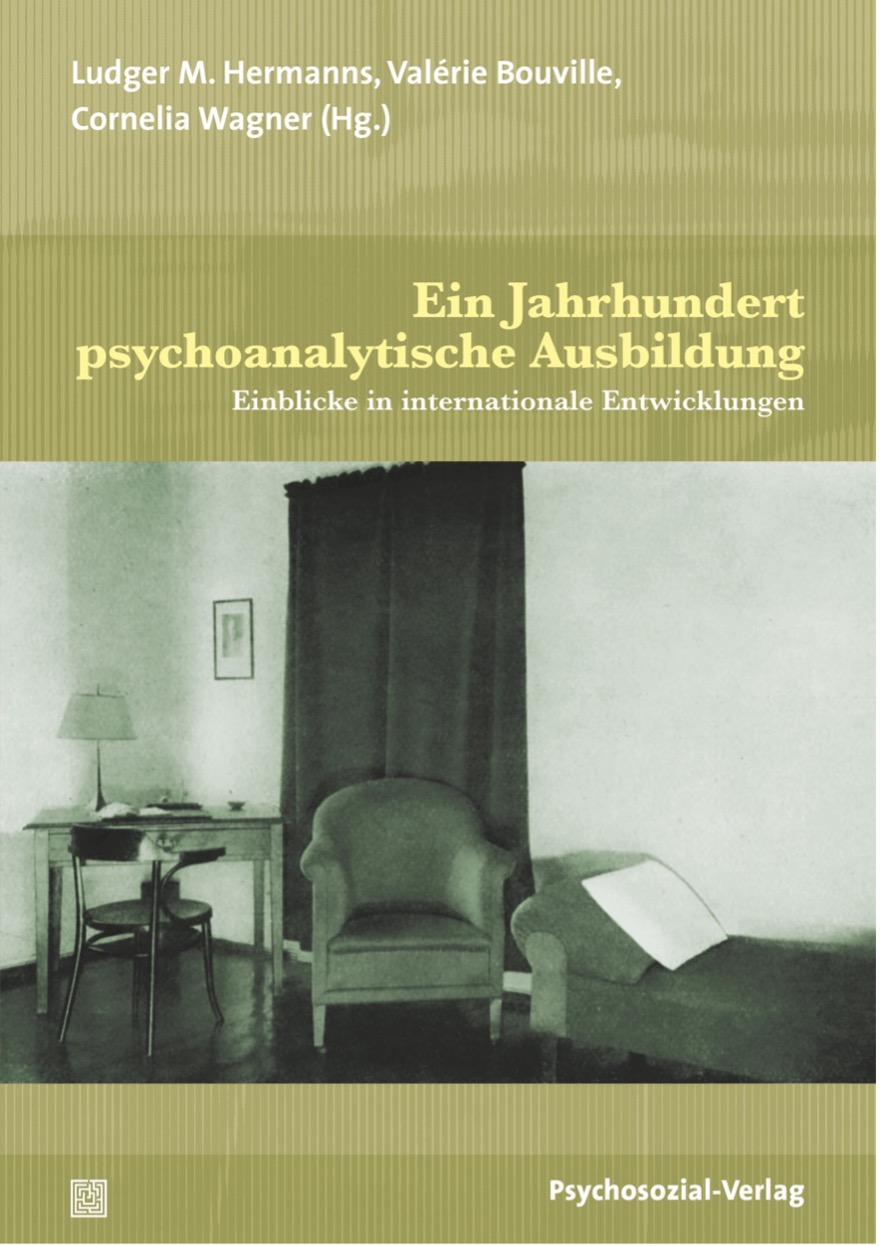
Etwa mehr als die Hälfte des Covers nimmt ein Foto im Querformat ein. In Resedagrün / Weiß zeigt es den leeren, aufgeräumten Arbeitsplatz eines oder des Analytikers. Der Raum ist diagonal angeschnitten und verleiht so dem Bild etwas Dynamik; er geht nach links hinten in die Tiefe. Dort in der Zimmerecke steht ein kleiner Schreibtisch diagonal in der Ecke. Darauf Schirmlampe, Notizbuch, Tintenfass, ein kleines Schälchen, davor ein Thonetstuhl ohne Polster mit Armlehnen schräg abgerückt vom Tisch. Über dem Schreibtisch ein nicht identifizierbares Portraitfoto. Singuläres ist nicht zu erkennen, keine Vorliebe derjenigen, die den Raum eingerichtet haben mögen. Fast in der Mitte des Fotos ein Sessel mit ansteigender Rückenlehne, ausgerichtet parallel zum Schreibtisch im 45-Grad-Winkel zur rechts davon stehenden Couch und zur Wand, hinterfangen von einem wahrscheinlich samtigen Vorhang. Mit ihm ist wohl ein Fenster verdunkelt oder die Tür zum Nachbarraum akustisch und visuell verhängt. Der Sessel vor dem Vorhang schafft eine fast feierliche Raumstimmung. Auf der einfachen Couch im selben 30iger Jahre Stil wie die anderen Möbel, ein frisch überzogenes, weißes Kissen, der Platz des Analysanden. Der Analytiker hat zwei Plätze. Einen, den er einnimmt während der analytischen Sitzung, und einen, um Notizen zu machen. Der Boden ist blitzblank. Keine Spuren, alles ganz neutral. Vielleicht handelt es sich um ein Foto aus einem Katalog für normgerechte Praxiseinrichtung.
Alle Diagonalen, die oft in Bildern eine Spannung andeuten, einen Sog erzeugen, sind hier durch die Lichtregie homogenisiert.
Die psychoanalytische Ausbildung berechtigt, so die grundlegende Fantasie des Buches, zur Einnahme der beiden Plätze links im Foto. In der Zeit der Ausbildung liegt man rechts auf der Couch.
Das Foto weicht deutlich von den bekannten Fotos aus Freuds Praxis in Wien oder London ab. Keine Bücher, keine Bilder, kein Relief, keine Teppiche, keine Statuen, nur ein weißes Kissen. Also deutlich nüchterner, kein Ornament.[3] Fast eine preußisch protestantische Antithese. Auf jeden Fall aber abstinent.
Erzählungen aus dem Innern der IPV
Das vorliegende Buch ist die Dokumentation der Vorträge, die auf der »wissenschaftlichen Tagung zur Erinnerung an die Gründung des weltweit ersten psychoanalytischen Ausbildungsinstitutes 1920 in Berlin« (8. bis 9. Februar 2020) als Tagung der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung (IPV) gehalten wurden. Diskussionen, wenn es sie denn gab, sind nicht notiert. Die Dokumentation bietet eine Zusammenschau von Erzählungen aus dem Innern der IPV. Der Fokus liegt auf der Kontinuität der 100 Jahre. Symptome, immer wieder andere Kompromissbildungen in Ausbildungsfragen der Psychoanalyse, tauchen auf, werden aber nicht als solche diskutiert. In die Erfindung von Symptomen, die von der programmatischen Berührung mit dem Unbewussten provoziert werden, sind Gruppierungen auch außerhalb der IPV involviert, wenige in Deutschland, mehrere kaum weniger als 100 Jahre international, mindestens seit 80 Jahren in Frankreich, in anderen romanischen Ländern und nicht zuletzt in Südamerika. Dieser Zusammenhang mit den diversen psychoanalytischen Strebungen existiert, auch wenn auf Vereinsebene bewusst kein direkter Austausch vorgesehen oder, mehr noch, unerwünscht ist. In diesem Buch finden sich nur Spurenelemente des real existierenden Geflechts.
Für Deutschland bleibt es ein Desiderat, gerade für die Zeit nach 1962[4] und der Kostenübernahme durch Krankenkassen, zur Kenntnis zu nehmen, dass es auch andere Bewegungen in Fragen der Bildung des Analytikers gegeben hat und gibt. Da sich die IPV der Tendenz nach für die Psychoanalyse hält, scheint ein psychoanalytischer Blick nach außen wie ein Luxus, den man sich nicht leisten muss. So kann der Leser den Eindruck gewinnen, dass es keine anderen Geschichten der (Aus-)Bildung gegeben haben dürfte.
Der Rezensent geht davon aus, dass Spaltungen, Machtkämpfe und Kompromisse einen Reichtum der Psychoanalyse ausmachen. Gerade in den oft nicht schönen Auseinandersetzungen liegt die nie erreichbare Wahrheit der Psychoanalyse. In den erfindungsreichen Symptomen unerkannter Konflikte finden sich Bildungen des Unbewussten – für die Forschung wie für die Praxis ein noch zu hebender Schatz. Der liegt allerdings auch darin, in der Praxis der Bildung des Psychoanalytikers über die Grenzen der jeweiligen Vereinigungen und Lehrmeinungen hinaus im Gespräch zu bleiben, und zwar keineswegs mit dem Ziel der Harmonie, sondern als Kenntnisnahme des jeweils in einer bestimmten Situation Verdrängten, Ausgeschlossenen und auch theoretisch zumindest nachträglich begründbar Abgelehnten.
Im Vorwort der Herausgeber wird erwähnt, dass die IPV die Planungsgruppe des Kongresses bat, von den aktuellen Auseinandersetzungen abzusehen, weil eine Polarisierung befürchtet wurde (S. 10). Die zeitliche Begrenzung der Tagung ließ eine Beteiligung »weiterer Gesellschaften« – was immer damit gemeint ist – nicht zu.
Eigentümlich vernebelnd auch der passivisch konstruierte Satz mit dem Institut als grammatischen Subjekt des Relativsatzes:
»Das heutige Berliner Psychoanalytische Institut [der DPV?; KJP] wurde 1950 neu gegründet und insofern nur [?] ideell als Nachfolgerin des alten Institutes gesehen, das 1936 seine Eigenständigkeit verlor und im von M.H. Göring geleiteten staatlichen Institut aufging« (S. 9).
Aufdringliche Fragen
Der Band enthält in Form von Überblicksdarstellungen zwar viele Informationen, die so noch nicht zusammengestellt wurden, aber inhaltlich Strittiges und konzeptionell Schwieriges wird nur angedeutet, nicht durchgearbeitet:
- Wird durch das Etikett »Lehranalyse« die Notwendigkeit einer Analyse für den Beruf des Psychoanalytikers umgangen?[5]
- Ist »Lehranalyse« nicht die Antwort auf einen Anspruch, einen Wunsch, Analytiker werden zu wollen? Geht es in einer solchen Analyse dann nicht eher um Bedürfnisbefriedigung als um Abstinenz?
- Wie können die im Buch Kandidaten und Lehranalytiker Genannten dem Exzess einer jouissance, eines Genießens der aktuellen (Lehranalytiker) und der zukünftigen Macht (Kandidaten) entkommen? Wie wird diese Gefahr kultiviert?
- Welche Effekte auf die Ausbildung hat die fast sichere Aussicht auf ein ausreichend zu nennendes Einkommen mittels einer der Psychoanalyse benachbarten Psychotherapie, die krankenkassenfinanziert ist, sowie auf die Psychoanalyse selbst?
- Es ist wohl im psychoanalytischen Sinn ein Symptom, Psychoanalytiker werden zu wollen. Welche Chancen hat dessen Bearbeitung?
- Was ist eigentlich das Begehren des Analytikers?[6] Ein Begehren bleibt ohne eine spezifische Antwort, geht immer über diese hinaus.
- Wie ist der Übergang von einem neurotischen Phantasma in eine offene Form des Begehrens zu denken, ein Begehren, Singularitäten zu erforschen, nicht als schon bekannt zu diagnostizieren, durch mutige Interventionen und erfindungsreiche Deutungen Symptome zu lockern und Neuformulierungen zu begünstigen, aber nicht heilen zu wollen?[7]
- Wäre nicht hier auch der politische Charakter des Unbewussten immer wieder zu formulieren?
- Wie kam es, psychoanalytisch gesehen, dazu, dass homosexuelle, genereller: queere Menschen von der Ausbildung ferngehalten wurden?
- Und nicht zuletzt: Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Anpassungsbereitschaft der Analytiker im Nationalsozialismus, erleichtert durch den erzwungenen, freiwilligen Ausschluss der Juden unter den Analytikern und der Form einer kaum psychoanalytisch inspirierten, medizinisch formatierten Ausbildungspraxis, die nur wenig Sinn für politische Zusammenhänge hatte, es sei denn den für seriöse Anpassung?[8]
Nach Überzeugung des Rezensenten geht es bei dem, was Ausbildung genannt wird und eher Bildung heißen könnte, um die Konstruktion einer geschützten Raumzeit, darum, den Wunsch in ein Begehren und ein Sprechen umzuwandeln. Ein solches Sprechen wird nicht nur Effekte auf den Einzelnen haben, sondern auf die Gesellung[9] und ihre Institutionalisierung und umgekehrt. Dabei ist diese Raumzeit ein Laboratorium mit je singulären Kombinationen des Mitgebrachten und des Gebotenen. Das Ergebnis wird unabsehbar sein. Auch für die Institutionen.
Ideal Kontinuität
Es scheint das Ideal der in der Dokumentation vorgestellten 100-jährigen Ausbildung zu sein, dass sie sich um das Modell Eitingons gruppiert, selbst gleichgeblieben ist – dazu noch weiter unten. Wobei einige Beiträge des Buches zumindest Anhaltspunkte dafür geben, dass das Modell der Intention nach ausgehöhlt, der Form nach immer wieder repariert und kaum konzeptionell weiterentwickelt wurde. Auch wenn der Wunsch nach Kontinuität verständlich ist, bis in die Technik hinein, hat Freud immer wieder für Veränderung als Merkmal der Fortsetzbarkeit der Psychoanalyse plädiert. In einem Brief an Ferenczi[10] schreibt er, dass jeder von der einmal sich ergebenen Form abweichen könne, es müsse nur unter den Psychoanalytikern offen zur Diskussion gestellt werden. Das hinderte Freud nicht daran, dezidiert gegen Positionen, hier Ferenczis, Stellung zu nehmen. Er eröffnet damit weitere Auseinandersetzungen. In Ein Jahrhundert wird aber eher Dauer und Geschlossenheit favorisiert, Abweichungen durch Formelkompromisse geglättet[11].
Macht und Gewalt
Eine formalisierte Ausbildung ist eine (meist) kultivierte, zivilisierte Art der Machtausübung und idealerweise die Ausübung delegierter und legitimierter Gewalt in einer Demokratie.[12] Deshalb sind dauernde Neujustierungen und Erfindungen wünschenswert, wenn es um ein auch Psychoanalytikern nicht direkt greifbares Subjekt des Unbewussten geht. Subjekt ist hier verstanden als Unterworfenes unter die Sprache(n), als Thema und als Individuum, das Entscheidungen treffen muss. Greifbar ist das Unbewusste nur an seinen Bildungen und in der Nachträglichkeit. Erkennbare Bildungen des Unbewussten sind in der Regel Fehlhandlungen: Versprecher, Ungeschicklichkeiten, auch plötzliche auftauchende, so nicht erwartete Lösungen einer verfahrenen Situation, Symptome, Träume, Witze, acting out, passage à l‘acte. Es geht also jeweils um Überschüsse, die über das hinausgehen, was in einer normalisierten Situation zu erwarten wäre. Das ist das, was an etablierten Methoden abgleitet. Sie gehen vom schon Bekannten aus. ›Fehl‹ ist die Differenz von einigermaßen bewusster Intention und tatsächlicher Artikulation, etwas, das eine unterstellte Norm verfehlt und daran gemahnt, dass der Einzelne die Kontrolle über die Wirkungen seiner Handlungen nicht ganz hat. ›Fehl‹ kann auch zu viel sein.
Alle, die in Aktionsfelder einer Vorbereitung auf den Analytikerberuf geraten, werden es mit für sie unheimlich werdenden Übertragungsmanifestationen zu tun haben. Sie werden konfrontiert mit etwas außerhalb des heimisch institutionell Verfassten, dem, was in der Polis, im Politischen geschieht. Sie könnten Zeugnis ablegen von Veränderungen, demnach von der Grundlage, dem Subjekt der Weiterentwicklung der Psychoanalyse.
Erstes psychoanalytisches Ausbildungsinstitut
1920 wurde das weltweit erste psychoanalytische Ausbildungsinstitut gegründet. Auch davor gab es Ausbildung. Dies festzuhalten ist nicht trivial. Denn eine Gründung ist immer eine Kompromissbildung, eine Stilllegung, ein auf Wiederholbarkeit der Prozeduren angelegtes Symptom. Mythen erzählen oft von einem Mord bei der Gründung: z.B. Kain und Abel, Abraham an Isaak (beinahe), Ödipus, Romulus und Remus, Ludwig XVI. und Benno Ohnesorg (Studentenbewegung).
Die Zeit vor der Gründung bleibt, das wird nur knapp angedeutet, reichhaltig an Erfahrungen und steckengebliebenen Entwicklungen, z.B. unter dem Stichwort der Laienanalyse und der Unabhängigkeit von staatlichen Regulierungen. Interessant wäre auch das Verhältnis einer intentionalen Weitergabe, Tradierbarkeit dessen, was die Vorstellungen von Psychoanalyse sind, und deren unbewusste, asemantische Transmission auch in Form von Haltungen und Stil, die unversehens wieder wahrnehmbar werden können, eventuell überspringen sie dabei auch Generationen.[13]
Fassen könnte man in dieser Hinsicht die institutionalisierte Ausbildung eher wie ein Kontrastmittel denn als den Königsweg zu einem professionalisierten Analytikerberuf.
Bildung, Ausbildung, formation, training
Heribert Blaß wirft in seiner Einleitung zum Panel »100 Jahre Psychoanalytische Ausbildung« (S. 183ff) die Fragen der Bezeichnung auf, training, formation, Ausbildung, Bildung. Bildung wäre die Alternative zwischen einem stark strukturierten Curriculum und einer eher freien Art zu lehren.
Dass Bildung oder doch nur Ausbildung in der und für die Psychoanalyse notwendig ist, um sie zu praktizieren, wird kaum jemand bestreiten. Es macht einen Unterschied, in welcher Sprache das gehört wird. Nennt man den Weg training, formation, Ausbildung oder Bildung?
Das Buch generiert beim Leser weitere Fragen:
- Kann Ausbildung durch eine Prüfung abgeschlossen werden oder kann sie konzipiert werden als ein mehr oder weniger dichter Prozess von Erfahrungen, der nie oder nur vorläufig an ein Ende kommt?
- Gibt es einen Kanon dessen, was gewusst und gekonnt werden muss? In welchem Verhältnis dazu entwickelt sich eine Haltung und ein Stil?
- An welche institutionelle Vorbilder lehnt sich die Psychoanalyse an? Welche sind eher untauglich?
- Wie wirkt sich die intime Situation einer Analyse im Rahmen eines Instituts aus, das eine interne Öffentlichkeit und vermittelt auch eine externe braucht?
- Können beide Bereiche entkoppelt und wieder in Beziehung gebracht werden? Denn jede Analyse trägt zum Erkenntnisfortschritt der Psychoanalyse bei.[14]
- Muss die Psychoanalyse noch viel experimentierfreudiger nach einer adäquaten institutionellen Lösung suchen?
Ausbildung nur in der IPV?
So differenziert und abwägend einige Beiträge sind, eindeutig ist der basso continuo: Psychoanalytische Ausbildung findet unter weltweit verallgemeinerten, institutionalisierten Zielvorgaben nur im Rahmen der IPV und den ihr untergeordneten regionalen Gesellschaften statt. Ein bisschen imperial und kolonial ist das schon.
Die der Psychoanalyse als Konzept und Idee widerstreitenden Macht- und Gewalteffekte einer verallgemeinerten, für alle geltenden Ausbildungsordnung werden angedeutet. Die tatsächlichen Verbiegungen werden verschleiert. Nicht dass diese Effekte vermeidbar wären, sie könnten aber anders als in anderen Institutionen (z. B. in Universität, Kirche, Militär) aus der Eigenart und dem Wissen der Psychoanalyse heraus in die Gestaltung der Institutionen eingearbeitet werden. Der Kriminalroman von Batya Gur Denn am Sabbat sollst du ruhen von 1988[15] hätte hier ex negativo helfen können. Sehr weit fortentwickelt von den Strukturen anderer Institutionen und deren Ausbildungsordnungen hat sich, glaubt man den Beiträgen, die Psychoanalyse nicht. Dabei macht Psychoanalyse implizit das Ausbildungsgeschehen der genannten Institutionen zum Gegenstand, indem sie sich mit dem Unbewussten der Übertragung befasst, dem Sadismus und Masochismus des Lehrens und auch des Lernens.
Dass beispielsweise in Frankreich mit (Aus-)Bildungsmodellen experimentiert wird, dass dort versucht wird, den Macht- und Gewalteffekten Rechnung zu tragen im Rückgriff auf Kenntnisse und Erfahrungen aus der Psychoanalyse selbst, wird lediglich im Beitrag von Serge Frisch[16] erwähnt. Dass es aber auch innerhalb der IPV pointierte Erörterungen des Problems gibt, kommt kaum vor, jedenfalls gehört die zum Teil radikale Befragung der etablierten Ausbildungsmodalitäten nur am Rande zum Jahrhundert der Ausbildung.[17] Unbewusstes Übertragungsgeschehen und die Dynamik des Unbewussten, die nicht im herkömmlichen Sinne sichtbar, abfragbar und als Eigenschaft einzelnen Individuen zuzuordnen sind, werden nicht in produktiver Spannung zu einem anscheinend plan- und beherrschbaren, für alle in gleicher Weise produktiven Curriculum entfaltet. So wird die Eigendynamik der Institutionalisierung zwar erwähnt, es werden aber kaum Konsequenzen daraus gezogen.
Zertifizierte und garantierte Ausbildungen
Das Buch gibt einen guten Überblick über die von Autoritäten und Vereinen zertifizierten und garantierten Ausbildungen im Bereich der IPV, beendet mit einem Abschlusszertifikat, verbunden mit der Erlaubnis (!), einen Beruf auszuüben, die Vergabe einer Berufsberechtigung, ganz so wie das die Architektenkammer tut (Thomas Eichhorn, S. 41). – Man könnte das zu begründen versuchen, selbstverständlich ist es nicht. – Damit übernehmen die Ausbildungsinstitute auch eine Garantie für eine regelgerechte Ausbildung, deren Anforderungen in vielen Ländern in Verbindung zum Gesundheitssystem vom Staat vorgegeben sind, sodass die Ausbildung von Psychotherapeuten und Psychoanalytikern kaum mehr unterschieden wird.
Die Psychoanalyse wird wie ein anzueignendes Objekt behandelt, ein Korpus, der schon gesichert vorhanden ist. Die spezifische Zeitlichkeit, die in der Psychoanalyse entwickelt wurde, die der Nachträglichkeit, deren Einsatz nicht terminiert werden kann, spielt dann keine Rolle. Zugeständnis an die Besonderheit der Psychoanalyse ist die eigene Erfahrung als Analysand, allerdings als eines Ausnahmeanalysanden in Lehranalyse. Die hier vorgestellte Anwendung der Psychoanalyse als Praxis der Ausbildung ist zielorientiert und bei Abschluss garantiert. Diejenigen, die sich ihr unterzogen und eine Prüfung abgelegt haben, sind ausgebildet.
Das hat nichts mit Humboldts Konzept von Bildung zu tun.[18] Er sah das Potenzial des Bildungsprozesses an der Universität gerade darin, dass Bildung frei von den Einschränkungen einer zukünftigen Berufstätigkeit in Staat, Kirche und Wirtschaft zu konzipieren sei. Das Potential entfaltete sich dann aus der Reibung bei Berufseintritt zum Vorteil der Abnehmer als Innovation, zum Vorteil des Absolventen als Übersetzungsleistung des an der Universität Erfahrenen.
Lehranalyse
Dass ein Ziel einer Analyse festgezurrt wird und damit vorweg auch einigen Analytikern die Kompetenz zugesprochen wird, entscheiden zu können, wer denn für eine Lehranalyse geeignet sei, ist wohl eine zwangsläufige Folge der von Eitingon etablierten Struktur der Ausbildung mit den Elementen Lehranalyse, Supervision (in der Annahme, Supervision sei weniger kontrollierend als Kontrollanalyse) und Theorie. – Serge Frisch weist in diesem Buch darauf hin, dass man auch mit einer Analyse starten kann, die noch nicht Bestandteil einer Lehre ist. – Das innovative Moment Eitingons im Verhältnis zu allen bekannten Ausbildungsformen außerhalb der Psychoanalyse ist die sogenannte Lehranalyse. Wäre es nur Analyse, die eine Analyse gewesen sein wird, die zum Beruf des Analytikers geführt hat, wäre das klarer. Die Rede von Lehranalyse impliziert hingegen, dass es Lehre in der Kur geben kann und dass von vornherein ein Ziel und ein Zweck der Analyse gesetzt ist. So unterscheidet sich diese Kur von sogenannten therapeutischen psychoanalytischen Kuren. Eine Meisterlehre mit Innung und kanonisierter Theorie als Minimum wird etabliert.
Lehranalyse als Deutung
Die Bezeichnung »Lehranalyse« ist eine Deutung, die lange vor dem Moment gegeben wird, in dem sich ein Analysant der Wahrheit seines Begehrens nähert; man könnte auch im emphatischen Sinne Derridas von der Profession sprechen[19]. Der Gegensatz ist eine radikale Abkürzung: Das Ziel wird dem Weg dorthin vorweggenommen, eine Sonderform von Analyse kreiert.
Das muss nicht heißen, dass trotz dieses Etiketts, im Schatten dieses Vorgehens, kollateral Analyse geschieht, vielleicht nach dem Satz von Karl Valentin: »Ich nehm‘ den Fisch und tu ihn ertränken«.[20]
Vergessen scheint, dass Freud die Bezeichnung Lehranalyse anders verwendete: Jeder, speziell jeder Wissenschaftler, der sich in seinem Metier der Psychoanalyse widmen will, solle die Möglichkeit einer Lehranalyse haben[21], einer Reihe von Sitzungen, um die Erfahrung des Unbewussten und damit der Übertragung zu machen. Das empfiehlt Freud insbesondere für jene Personen,
»die die Analyse aus intellektuellen Motiven annehmen, die nebenbei erzielte Erhöhung ihrer Leistungsfähigkeit aber gewiss gerne begrüßen werden. Zur Durchführung dieser Analysen bedarf es einer Anzahl von Analytikern, für die etwaige Kenntnisse in der Medizin besonders geringe Bedeutung haben werden. Aber diese – Lehranalytiker wollen wir sie heißen – müssen eine besonders sorgfältige Ausbildung erfahren haben.«[22]
Aus der persönlichen, der eigenen Analyse (S. 13) wird unter Bedingungen der Ausbildung eine Lehranalyse und werden aus einigen Analytikern Lehranalytiker. Damit entstehen zwei Sorten von Analyse. Diese bemerkenswerte Entwicklung wird in der Dokumentation nachgezeichnet – weder als irritierend noch argumentativ zu begründende.
Auschwitz: Folgewirkungen auf die Psychoanalyse?
Dass die politische Geschichte der Psychoanalyse in Deutschland nicht nur im Nationalsozialismus mit der Art ihrer Institutionalisierung und damit verbundenen Ausbildungsformen in einem Zusammenhang stehen könnte, wird verdeckt mit Wendungen wie »grundsätzlicher Kollaps der Psychoanalyse in Deutschland« (S. 10) aufgrund äußerer Einwirkungen.
Es bleibt die Frage, ob Institutionalisierungsformen, die aus einer voranalytischen Zeit stammen, nicht auch deren Haltungen und Stil mittransportieren. Insbesondere dann, wenn das genuin Psychoanalytische, die jeweils eigene Analyse, in ein und demselben Institut von einer durch staatliche Anforderungen kanonisierten Lehre und Kontrollanalyse gerahmt werden.
Der Rezensent fand bei der Lektüre kaum Spuren einer Antwort auf die Frage, die Anne-Lise Stern gestellt hat: »Ergeben sich aus Auschwitz besondere Folgewirkungen auf die Psychoanalyse als Theorie und Praxis und auch auf die psychoanalytische Gemeinschaft in ihrer Gesamtheit?«[23]
Psychoanalyse im Nationalsozialismus
Stattdessen stehen Mitglieder der IPV »gemeinsam für das Schicksal der Psychoanalyse in der Zeit des Nationalsozialismus«[24] ein und beginnen allmählich »anzuerkennen, dass es in der Entwicklung der Psychoanalyse in Deutschland einen großen Bruch gegeben hatte« (S. 13). – Das sind Bekenntnisse, aber keine Analysen der Schuld. So passiert wohl auch die von Ludger M. Hermanns bedauerte Fehlleistung, dass das »Fortleben seines [Eitingons; KJP] Ausbildungsmodells im von Eitingon 1934 neu gegründeten Jerusalemer Institut nicht in einem Beitrag gewürdigt« (S. 18) wurde, wobei ›würdigen‹ auch eine »neuerliche Prüfung«[25] sein kann.
»Aber es war doch die hundertjährige Tradition seiner Ausbildungsidee, die das Zerstörungswerk in NS-Deutschland international überstanden hat, der diese Tagung ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung setzen wollte« (S. 18).
In solchen Aussagen passiert implizit eine Verwechslung, auf die Roland Kaufhold und Galina Hristeva kürzlich noch einmal hingewiesen haben.[26] Es galt nicht primär, die Psychoanalyse zu retten, die auch nicht gerettet wurde, es sei denn in einer bereinigten Form: Die jüdischen Mitglieder der DPG wurden als Juden verfolgt, nicht als Psychoanalytiker. Die Verwechslung wird in Berlin durch Gedenktafeln an den Häusern, wo diese praktiziert hatten, nahegelegt.[27] Arische Psychoanalytiker wurden im Göring-Institut nicht verfolgt, aus- oder eingesperrt. Die jüdischen Psychoanalytiker wurden als Juden von den eigenen Kollegen ihrer Existenzgrundlage beraubt. Ihnen wurden sogar danach noch Mahnbescheide über nicht bezahlte Mitgliedsbeiträge ins Exil nachgeschickt.[28] Zugespitzt: Die biodeutschen Psychoanalytiker verrieten mit Unterstützung der IPV die Analytiker jüdischer Provenienz[29], damit auch Freud und die Wiener Kollegen[30], von denen sie die Psychoanalyse übernommen hatten. Unter dem Schirm einer scheinbar zur Rettung der Psychoanalyse notwendigen Anpassung an den Nationalsozialismus fand ein Kampf gegen deren Pioniere statt, von der Struktur her nebenbei ein brutal ausgetragener Generationenkonflikt mit der zumindest zeitlich ersten Gruppe von Analytikern in Wien und anderswo, die zumeist Juden waren, ganz zu schweigen von Freud. Dadurch wurde die Psychoanalyse deutscher, etwas grob vereinfacht auch hermeneutischer, gemischt mit medizinisch naturwissenschaftlichen Anteilen[31]. Sie wurde an den wissenschaftlichen Mainstream angepasst. Alle, die davon abwichen, finden sich bis in die Gegenwart hinein an den Rand gedrängt.
Statt zu suggerieren, dass die Psychoanalyse als solche bekämpft wurde und sich heldenhaft gewehrt habe, dass sie einem Schicksal unterlag und ein großer Bruch sich ereignete, ist es im Gegenzug jedoch auch nicht besonders spannend und psychoanalytisch sogar zweifelhaft, einzelne Schuldige auszumachen, die aus welchen Gründen auch immer meinten, durch eine Kooperation mit den Nationalsozialisten die Psychoanalyse retten zu können. Es ist mit heutigem Abstand aber möglich, die Kontinuität zu befragen, die mit den 100 Jahren behauptet wird. Der sogenannte »große Bruch« hat offenbar nichts grundlegend an der Art der Rekrutierung und Bildung in der Psychoanalyse geändert, er findet sich eher als ein zu reparierender, nicht als einer, der Neuerungen generiert. Es sei ohne Scham die Frage gestellt, ob die Kassenfinanzierung psychoanalytisch inspirierter Therapie zum Wohle psychischer Kranker nicht auch Züge einer freiwilligen Wiederholung der Mitgliedschaft im Göring[32]-Institut (Deutsches Institut für psychologische Forschung und Psychotherapie) hat, ob sie weniger, oder zumindest nicht nur, dem Wohl der Patienten dient als vielmehr der gesellschaftlichen Anerkennung und dem sicheren Einkommen von Analytikern. Das hat, wie auch im Buch immer wieder schüchtern angedeutet, Effekte auf die Inhalte und den Stil der Ausbildung, die Rekrutierung und die Theoriebildung in der Psychoanalyse. – Um das klarzustellen: Es sollte viel Fantasie darauf verwendet werden, im Prinzip allen, die das möchten, den Zugang zur Psychoanalyse auch ökonomisch zu ermöglichen. Das wäre einer eigenen Abhandlung wert. Sicher wird das Ziel nicht erreicht durch die Verknappung von Kassensitzen und deren stückchenweisen Verkauf.
Klaus Grabska allerdings macht deutlich: »Und doch gibt es keine Kontinuität, sondern einen katastrophalen Bruch in unserer Geschichte. Die Nazizeit und die schreckliche Verfolgung unserer jüdischen Kollegen führten zu einem grundsätzlichen Kollaps der Psychoanalyse in Deutschland.« (S. 23)
Betrifft der Kollaps die organisatorischen Strukturen, die Anerkennung durch die IPV, den Streit zwischen DPV und DPG, die Arbeitsweise der Institute, die Form der Ausbildung, die Überzeugung, die zur »Empfehlung« des Austritts der jüdischen Kollegen führte, und die Affinität zur »deutschen Volksgesundheit«? Das wird in der Dokumentation nicht weiter ausgeführt. Kann die Nazizeit bewältigt werden? Muss sie nicht eher durchgearbeitet werden? Und das nicht nur als manifester Inhalt?
Dabei würde die Psychoanalyse wohl nicht nur in Deutschland eine andere.
Zwischenbemerkung
Der Rezensent möchte betonen, dass er als Psychoanalytiker keineswegs außerhalb dieser Geschichte steht, auch wenn er nicht Mitglied der IPV ist, allerdings eine Ausbildung nach IPV-Richtlinien absolviert hat. Vielleicht schwingt in mancher Kritik am Buch auch eine enttäuschte Hoffnung mit. Er wollte einen Teil der Durcharbeitung im vorliegenden Buch finden. Denn auch Analytiker, die sich an der französischen Psychoanalyse orientieren, sind keineswegs außerhalb der Anforderung, sich mit der Geschichte der Psychoanalyse in Deutschland und anderswo zu befassen. Auch eine begründete Ablehnung einer, wie im Buch favorisierten, formalisierten Ausbildung bringt Tradition und unbewusste Transmission, in der jeder in der Psychoanalyse steht, nicht zum Verschwinden.
»Das alte Berliner psychoanalytische Institut«
So heißt die Überschrift über Michael Schröters Beitrag. Das klingt nostalgisch, beginnt aber mit einem sehr aktuellen Bezug. Freuds Wunsch sei es gewesen, seine Lehre an der Universität anzusiedeln. Das ließ sich damals nicht verwirklichen. »Derzeit gibt es in Deutschland starke Bestrebungen, die psychotherapeutische und damit auch die psychoanalytische Ausbildung der Regie privater Institute zu entziehen, sie zumindest teilweise in die Universität zu verlagern und in höherem Maße als bisher staatlich zu reglementieren.« (S. 27)
Kein Wort davon, dass sie dann in eine Universität käme, die sich gegenüber den Bedingungen um 1920 stark verändert hat. So ist es kaum gelungen, für die größere Anzahl von Studierenden veränderte Bedingungen zu schaffen. Schröter argumentiert so, als wenn die Universität unter veränderten gesellschaftlichen Anforderungen an Bildung und Ausbildung – meist ökonomistisch formuliert –, nicht in weiten Teilen zu einer Berufsakademie gemacht worden wäre. Sie leidet an Unterfinanzierung[33], an Vorgaben einer fetischisierten Effektivität, stark an denen wirtschaftlicher Produktivität angelehnt. Immerhin wäre es, könnte man zynisch sagen, eine Gemeinsamkeit mit dem Gesundheitswesen, in dem auch tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie finanziert, optimiert und quantitativ evaluiert wird. Es passt wieder alles zusammen.
Schröter charakterisiert die Situation um die Berliner Institutsgründung herum, nachdem Karl Abraham vergeblich versucht hatte, eine außerordentliche Professur zu erlangen, so:
»Die Freudianer, die sich daran gewöhnt hatten, ihre Arbeit in der Esoterik von selbstgeschaffenen Institutionen – Kongresse, Zeitschriften, Verein, Verlag – zu organisieren, mussten auch ihre Ausbildung in die eigene Hand nehmen.« (S. 27)
Schröter trifft mit dem beobachteten Abschluss nach außen etwas Richtiges. Er scheint aber nicht den Kern der Schwierigkeit zu verstehen, der darin liegt, dass es sich bei der Psychoanalyse und speziell bei der Ausbildung um den Versuch einer indirekten Wahrnehmung im Sinne des Arbeitens mit dem Unbewussten handelt, das nicht im positivistischen Sinne direkt greifbar ist und sich in den einzelnen Menschen in Relation zu anderen sehr unterschiedlich artikuliert und der Verschwiegenheit bedarf. Das Ganze findet in Übertragung statt, die nicht, wie in der Universität, nur billigend, meist verdrängt in Kauf genommen wird. Es braucht zweifelsohne einen Schutz, aber Schröter hat darin recht, dass die Psychoanalyse nur dadurch zu einem ernstzunehmenden Gesprächspartner wird, wenn sie ihre Inhalte immer wieder durch andere, fremde Diskurse, nicht nur ornamental hindurchlaufen lässt und sich dadurch erneuert.
Innereuropäische Migrationsbewegung
»Der Glanz der Psychoanalyse in den Weimarer Jahren, und damit des Berliner Instituts, verdankte sich weitgehend einer großen innereuropäischen Migrationsbewegung, die hauptsächlich Juden betraf. Er verblasste ab 1930, als führende Dozenten und Lehreranalytiker – Alexander, Radó, Sachs und Horney – nach Amerika zogen, wo sie wiederum nach Berliner Vorbild neue Institute schufen und maßgeblich am Aufbau neu gegründeter Institute mitwirkten.« (S. 35)
Siegfried Bernfeld, geboren in Lemberg/Lwiw, der in seinem letzten Vortrag vor seinem Tod, nicht zuletzt aus seinen Erfahrungen als Lehranalytiker in San Francisco, eine grundsätzliche Kritik am bisherigen Ausbildungsmodell ausarbeitete[34], wird hier nicht genannt. Er war nach seiner Flucht Mitbegründer einer äußerst produktiven psychoanalytischen Arbeitsgruppe in den USA. Als 1942 die Arbeitsgruppe als San Francisco Psychoanalytic Society and Institute zum konstituierenden Mitglied der American Psychoanalytic Association wurde, bedeutete das den Ausschluss von Bernfeld, Erik Erikson, Anna Maenchen, Nevitt Sanford und weiteren ›Laienanalytikern‹ von der Kandidatenausbildung. Die interdisziplinäre Kooperation ging verloren. Zur Gruppe gehörte auch der Physiker Robert Oppenheimer, der Konstrukteur der Atombombe. – Auch eine Form von Kontinuität.[35]
»Nur als Ehrenmitglied der Gesellschaft war es Bernfeld gestattet, auch weiter zu lehren, zu supervidieren und Lehranalysen durchzuführen.«[36]
Genauer trifft wahrscheinlich Nathan Adler den Sachverhalt:
»In 1942 the San Francisco Psychoanalytic Society was accepted as a member of the American Psychoanalytic Association. Though Bernfeld was the recognized leader of the psychoanalytic movement in San Francisco, a founding member of the San Francisco Psychoanalytic Society and Institute (now the San Francisco Center for Psychoanalysis) and its foremost teacher, he was permitted only an honorary membership, as the American did not grant full membership to analysts without medical degrees. Though frustrated with the Institute’s policies regarding lay analysts, its hierarchies, and other typical pitfalls of bureaucratization, Bernfeld maintained his affiliation with the Institute and continued to teach there. In 1944, however, he started his own informal training program at his home. This unauthorized training, clearly in violation of the rules of the American, began with a small group that included Suzanne Bernfeld, Nathan Adler, Agnes Ain, Steven Pepper, Marian Russell, and a couple of others (N. Adler, personal communication, November 1990).«[37]
Lehre und Analyse
Freud hatte, wie Thomas Aichhorn schreibt (S. 41), die Schwierigkeiten einer direkten, erzählend und argumentativ aufgebauten Lehre erkannt. Er setzte zwar weiter auf mündliche Wissensvermittlung, nahm aber keine Menschen in Analyse, die sich ihm als Schüler andienen wollten. Aichhorn weiter:
»Das Modell rationaler Wissensvermittlung, an dem Freud damals noch orientiert war, hatte sich als unbrauchbar erwiesen, zwischen vorschneller Leichtgläubigkeit und Unglaube war kein Mittelweg in Sicht. Der latenten Übertragung und den daraus resultierenden Behandlungswünschen entzog sich Freud, die Einsicht in die Notwendigkeit einer Lehranalyse hatte er damals noch nicht.« (S. 44)
Dass er diese Notwendigkeit je erkannt hätte, kann mit Fug und Recht bestritten werden. Die Forderung einer eigenen Analyse oder einer Selbstanalyse hat Freud als unerlässlich angesehen. Nur in der eigenen Analyse kann man Erfahrungen mit dem Unbewussten machen, sodass die Bildungen des Unbewussten bemerkt werden können und zuletzt der Analysand von der Existenz des Unbewussten überzeugt ist.[38] Die Lehranalyse ist mehr und etwas anderes; sie ist Lehre, spielt in einem anderen Register und ist ein Vorzeichen, das auf ein Ziel, einen Zweck der Analyse hindeutet.
»Ich rechne zu den vielen Verdiensten der Züricher analytischen Schule, daß sie die Bedingung verschärft und in der Forderung niedergelegt hat, es solle sich jeder, der Analysen an anderen ausführen will, vorher selbst einer Analyse bei einem Sachkundigen unterziehen. Wer es mit der Aufgabe ernst meint, sollte diesen Weg wählen, der mehr als einen Vorteil verspricht; das Opfer, sich ohne Krankheitszwang einer fremden Person eröffnet zu haben, wird reichlich gelohnt. Man wird nicht nur seine Absicht, das Verborgene der eigenen Person kennenzulernen, in weit kürzerer Zeit und mit geringerem affektiven Aufwand verwirklichen, sondern auch Eindrücke und Überzeugungen am eigenen Leibe gewinnen, die man durch das Studium von Büchern und Anhören von Vorträgen vergeblich anstrebt.«[39]
Freud behielt allerdings seine Skepsis gegenüber der Reichweite einer Analyse für werdende Analytiker bei und nannte sie nie Lehranalyse. Allerdings kommt er in die Nähe einer solchen Bezeichnung, wenn er schreibt, dass eine Analyse für zukünftige Analytiker
»nur kurz und unvollständig sein kann. Ihr hauptsächlicher Zweck ist, dem Lehrer ein Urteil zu ermöglichen, ob der Kandidat zur weiteren Ausbildung zugelassen werden kann. Ihre Leistung ist erfüllt, wenn sie dem Lehrling die sichere Überzeugung von der Existenz des Unbewußten, ihm die sonst unglaubwürdigen Selbstwahrnehmungen beim Auftauchen des Verdrängten vermittelt und ihm an einer ersten Probe die Technik zeigt, die sich in der analytischen Tätigkeit allein bewährt hat.«[40]
Das spricht für die von Serge Frisch in diesem Band nahegelegte Reihenfolge: erst Analyse, dann Ausbildung. Problematisch in der Formulierung Freuds ist aber, dass ein Analytiker aufgrund dessen, was er in der Analyse gehört hat, möglicherweise ein Urteil über die Zulassung zur Ausbildung, wohl vor Kollegen, fällt oder an einer solchen Entscheidung beteiligt ist. Leicht gerät man in Widerspruch zum Schweigegebot und der Vertraulichkeit des Sprechens in der Analyse.
Genau an dieser kritischen Stelle hat später Jacques Lacan das Dispositiv der passe zur Diskussion gestellt, das in mannigfachen Versionen in der Folge auch in Verarbeitung von Fehlschlägen weitergeführt worden ist. Charakteristikum ist die Ablösung von der Analyse und der forschenden Öffnung durch die Rede des ehemaligen Analysanten vor Kollegen aus nicht nur der psychoanalytischen Vereinigung, deren Mitglied er werden will, die dies hinwiederum vertraulich und umgearbeitet als Ergebnis einer gemeinsamen Arbeit der Mitgliederversammlung vorstellt.[41]
Man muss nicht auf Freud rekurrieren. Wenn aber eine Kontinuität der Ausbildung erzählt wird, wäre es interessant zu rekonstruieren, welche Diskontinuitäten in der Entwicklung liegen.
- Ist Freud in Fragen der Ausbildung überholt?
- Haben sich Bedingungen grundlegend geändert?
- Es könnte auch die Frage aufgeworfen werden: Warum dauerte die Ausbildung 1920 sechs bis 18 Monate? (Flynn, S. 58)
Freud hatte mit der Gründung der Mittwoch-Gesellschaft Strukturmerkmale nicht nur einer psychoanalytischen Schulbildung, sondern auch, so könnte angenommen werden, »eine spannungsreiche Balance zwischen Institution und Privatheit, Distanzierung und Gefühlsbindung, Wissensvermittlung und affektiver Selbsterkenntnis bestimmt« (Aichhorn, S. 45), die ebenso Elemente einer Ausbildung sein könnte. Es war vor der Teilnahme keine Ausbildung zu absolvieren, Bedingung war der regelmäßige Besuch und einen Vortrag zu halten.
Großbritannien
Mit dem Bericht über die britische Geschichte der psychoanalytischen Ausbildung taucht im Streit um die Positionen von Melanie Klein ein weiterer Aspekt der Ausbildung auf: Erforschung und Arbeit mit psychotischen Zuständen. Ohne den Streit und die Einigung durch Aufteilung der Britischen psychoanalytischen Gesellschaft in drei Sektionen (S. 66) hier nachzuzeichnen, sei ein m.E. bedenklicher Teil der Übereinkunft genannt, dass der »Hauptzweck einer Lehranalyse wie einer therapeutischen Analyse darin bestehen muss, normales seelisches Funktionieren zu ermöglichen«[42] (S. 67).[43] Woher kommt diese Norm? Oder ist das die ironische Version einer Norm, wie sie Winnicott formuliert hatte, »gut genug«, ohne festzulegen, was genug ist?
Frankreich
Christian Seulins Beitrag zur Geschichte der Psychoanalytischen Ausbildung in Frankreich macht auf eine anfängliche Spannung aufmerksam: Die Analyse zog die Aufmerksamkeit von Intellektuellen und Künstlern auf sich und erweckte bei den Medizinern Argwohn. Die Société Psychanalytique de Paris (SPP) hat dagegen das »Ziel, alle Mediziner französischer Sprache zu versammeln« (S. 76), die ein Interesse an der Psychoanalyse haben. Um die Ausbildung kommt es zu Konflikten. Einmal geht es um die Dauer und Frequenz von Sitzungen. Zunächst hatte Sasha Nacht Sitzungen à 45 Minuten und eine Frequenz von drei Sitzungen pro Woche eingeführt, dann beantragte Lacan Kurzsitzungen. Ein Streit bricht aus um die Ansiedlung der Ausbildung in einem privaten und unabhängigen Institut (Bonaparte und Nacht) oder in Form einer Brücke zur Universität (Lagache). Darin impliziert war der Vorwurf des Autoritarismus gegen Nacht, formuliert auch von Ausbildungskandidaten. Es geht quer dazu um das Spannungsfeld zwischen subversiver Wahrheit der Analyse und der Forderung nach Struktur und Ordnung (S. 80). Angegriffen innerhalb der SPP wir das Konzept »Lehranalyse«. Das führt dazu, dass Analysen bei allen Mitgliedern der SPP als Voraussetzung der Zulassung zur Ausbildung gelten.
In der Abschaffung der Lehranalyse, zunächst in der Société Française de Psychanalyse (SFP), dann in der Association Psychanalytique Française (APF), stimmen Lacan und Laplanche überein.[44]
Anrecht der Armen
Orna Ophir erzählt, dass im New Yorker Psychoanalytischen Institut »die ›Hohepriester‹-Ärzte und Lehranalytiker von den regulären Mitgliedern, die selbst Mediziner waren, durch eine Samtkordel getrennt waren, während die jungen Kandidaten nur in den hinteren Reihen sitzen konnten.« (S. 87)
»Heute bietet das Institut, das nun den Spitznamen ›NYPSI‹ trägt, Sozialarbeitern Kaffee und Kekse an, um sie anzulocken, nachdem es in einigen Jahren überhaupt keine Bewerber für die Ausbildung hatte.« (S. 87)
»Im Gegensatz zum ursprünglichen europäischen Modell, das im Berlin der Weimarer Republik oder im Roten Wien praktiziert wurde und bei dem die kostenlose Behandlung der Allgemeinbevölkerung durch angehende Psychoanalytiker im Mittelpunkt des Ausbildungsprozesses stand, waren die Bemühungen um eine kostengünstige Behandlung der Allgemeinbevölkerung durch Kandidaten in den Ausbildungsinstituten in New York nie erfolgreich […], und die Analyse der Kandidaten anstelle der Behandlung von Ambulanzpatienten durch Analyse wurde zum zentralen Bestandteil der Ausbildung.« (S. 88)
Orna Ophir berichtet beispielhaft über die hierzulande kaum bekannte Caroline Newton, Übersetzerin von Thomas Mann, Jakob Wassermann und W.H. Auden, und ihr Schicksal im New Yorker Institut. Newton ging für eine Zeit nach Wien, machte Analyse bei Freud, nahm 1922 zum ersten Mal an einer Sitzung der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung teil und beeindruckte Freud mit der Idee, »dass Tausende von Sozialarbeitern an Freuds Theorie und Praxis interessiert sein könnten.« Wie Freud 1918 in Budapest betont habe, dass auch die Armen ein Recht auf seelische Hilfeleistung hätten (S. 91f). »Und daß die Neurosen die Volksgesundheit nicht minder bedrohen als die Tuberkulose« (Freud)[45]. Newton neigte eher der Wiener Tendenz zu, die Psychoanalyse auf alle Bereiche der Therapie und der Pädagogik zu beziehen, denn als medizinisches Spezialfach zu etablieren. In Wien wurde »eine Vielzahl« von begabten Personen aus Jura, Philosophie, Geisteswissenschaften und Pädagogik in Ausbildung genommen wie Anna Freud, Ernst Kris, August Aichhorn, Berta Bornstein, Erik Erikson, Otto Rank und Hanns Sachs. Newton übersetzte Ferenczi und Rank, war Gast des New Yorker Instituts, wurde aber ausgeschlossen, als sie sich als Analytikerin selbstständig machte und eine psychoanalytische Ambulanz aufbauen wollte.
Newton wurde zum Testfall (Peter Gay) im Streit zwischen Freud und seinen amerikanischen Anhängern (S. 97). Dabei ging es um die Freizügigkeit der Analyse, um das gegenseitige Vertrauen in unterschiedliche Zugänge und Wege zu ihr. Die Konflikte schwelen weiter:
»Freuds Albtraumszenario, dass staatlich bestellte Prüfungsausschüsse über die psychoanalytische Ausbildung und Zertifizierungsverfahren entscheiden und diese regulieren, ist im Staat New York teilweise verwirklicht worden« (S. 105),
stellt Orna Ophir in ihrem sehr lesenswerten Beitrag fest. – Eine Ähnlichkeit mit dem, was Bernfeld in San Francisco widerfuhr, ist erkennbar.
Argentinien
Marcela Bouteiller berichtet über die Ausbildung in Argentinien, dass 1933 eine Gruppe argentinischer Schriftsteller Freud wegen des Antisemitismus in Europa einlud, sich in Argentinien niederzulassen. Seine Bücher waren in Buenos Aires ausverkauft. – Dass Marie Langer als Jüdin aus Wien floh, liest sich so: »Ihr Lehranalytiker war Richard Sterba. Sie kam 1942 nach Argentinien.« (S. 114)
Einer der Pioniere der argentinischen Psychoanalyse, Celes Cárcamo, »stammte aus einer Familie von Großgrundbesitzern. Er war ein Liebhaber der argentinischen Gebräuche und studierte Medizin. Die Synthese dieser Einflüsse lässt sich in seinem Werk erkennen.« (S. 113)
Bei Bouteiller kann man nachlesen, wie stark der Austausch mit anderen lateinamerikanischen Ländern und Europa war. Zentriert um die Entwicklung der formal notwendigen Ausbildung nach APA-Richtlinien. 1972 kam Serge Leclaire nach Argentinien und ab da wurden Lacans Ideen Teil des offiziellen Lehrprogramms, »wobei Fragen zu den lacanianischen Konzepten, wie man Analytiker wird, beiseite gelassen wurden.« (S. 118)
Deutschland nach 1945
Über die Entwicklungen in Deutschland nach 1945, »nach dem politischen, sozialen und moralischen Zusammenbruch des sogenannten Dritten Reichs« (S. 121), schreibt Ingo Focke.
Seinen Beitrag liest man am besten von hinten (ab S. 133) nach vorne. Dort werden nach dem Durchgang durch die komplizierte Geschichte der Psychoanalyse in Deutschland nach 1945 entscheidende Konsequenzen für die Veränderung der Ausbildung deutlich genannt, ohne dass diese konzeptionell als solche vorgesehen waren oder theoretisch erarbeitet wurden. Focke nennt die Streitigkeiten zwischen einzelnen Analytikern und Fraktionen. Als Leser gewinnt man den Eindruck, dass diese Streitigkeiten Effekt eines nichtdurchgearbeiteten Weiterwirkens der Gewalt des NS-Regimes gegen Juden sind. Expliziert wird das nicht.
Die Nichtbefassung mündete in der Folge als Integration der Psychoanalyse ins Gesundheitswesen, fast als wäre damit alles wieder heil. Psychoanalyse wurde, so Focke, in Deutschland zum Machtfaktor in der Gesundheitspolitik, die Ausbildung endet mit einer staatlichen Prüfung, die für Psychologen zu einer Approbation führt. Die Berufsausbildung mit folgender Kassenabrechnung lockt Nachwuchs an. Die zunehmende Regulierung des Gesundheitswesens durchtränkt die Anforderungen an die Ausbildung und erschwert die Entwicklung einer psychoanalytischen Haltung und eines solchen Denkens. Die Professionalisierung der Psychotherapie wurde, so Focke lakonisch, von »Psychoanalytikern gestaltet im Dienste der Wahrung von Einfluss und der Absicherung der wirtschaftlichen Existenz«. Dadurch gewannen die Kostenträger einen erheblichen Einfluss auf die psychoanalytische Ausbildung. »Heute hat es die Psychoanalyse schwer sich zu behaupten.« (S. 137)
Der Beitrag muss notgedrungen vieles abkürzen, gibt aber einen roten Faden durch die Entwicklung, die man auf der Basis der Nachzeichnungen Fockes weiterverfolgen kann. Gestolpert bin ich über eine Einleitungsfrage: »Wie kann man ein deutscher Psychoanalytiker werden, wie kann man ein deutscher Psychoanalytiker sein?« (S. 122) Gemeint ist wohl die Frage, wie man in Deutschland, bei/mit/angesichts? der Geschichte immer wieder Psychoanalyse praktizieren kann, wo doch 1933 die jüdischen Mitglieder der DPG von der DPG ausgestoßen wurden (S. 123). Focke zeichnet nach, zu welchen Verwerfungen und Wiederholungen dieses Erbe führt. »Die Psychoanalyse stand ausdrücklich nicht im Zentrum der damaligen Initiativen, obwohl sie von Mitgliedern der ehemaligen DPG vorangetrieben wurden.« (S. 124) Ein seltsamer Satz, der Anlass für weitere Ausdeutungen geben könnte. Viele der in Deutschland Gebliebenen verstanden sich als Opfer. Eine zumindest latente Feindschaft gegen Psychoanalyse zugunsten integrativer Konzepte der Volksgesundheit blieben. Und ebenso immer wieder wie bei Annemarie Dührssen eine bemerkenswerte Art, nach spezifisch jüdischen Elementen in der Psychoanalyse[46] zu suchen bzw. erkennbar jüdische Elemente als schon lange in der europäischen Tradition bekannte Themen zu behandeln. Antisemitismus kann man das nicht nennen. Vielleicht nur wegen der essentialistisch ausgerichteten Erkenntnispolitik dann doch latenten Antisemitismus.
Fockes Beitrag benennt die kritischen Punkte. Aber es bleibt auch bei ihm unklar, was der Zusammenhang zur Ausbildung wäre.
Notwendigkeit einer eigenen Analyse
Eike Hinze spricht wunde Punkte des Konzeptes der Lehranalyse in seinem Beitrag bewusst und aus Versehen an. Er entwickelt nichts aus dem langen Zitat aus Freuds »Ratschlägen für den Arzt bei der psychoanalytischen Behandlung« (S. 142), das er für die Einführung der Lehranalyse durch Freud hält, wovon er selbst zutreffender Weise sagt, dass hier von der »Notwendigkeit einer eigenen Analyse« gesprochen wird. Eine eigene Analyse ist keine Lehranalyse. Freud spricht von der Beziehung zwischen »dem Analysierten und seinem Einführenden«. Eine Einführung ist nicht zwangsläufig eine Lehre, ebenso wenig muss sie didaktisch sein, wie es die Bezeichnungen in den romanischen Sprachen nahelegen. In »Die Frage der Laienanalyse« – die übrigens im gesamten Buch kaum diskutiert, nur als Bezeichnung konstatiert wird – macht Freud den Vorschlag der sorgfältigen Ausbildung von Lehranalytikern für Geisteswissenschaftler, um der wichtigen Anwendung der Psychoanalyse in den Wissenschaften gerecht zu werden. Er sieht Psychoanalyse als Forschungsmittel in unterschiedlichen Wissenschaften und nicht nur im Gebrauch der Analyse zwecks Therapie der Neurosen[47]. »Das Ganze erfordert aber ein gewisses Maß von Bewegungsfreiheit und verträgt keine kleinlichen Beschränkungen.«[48]
Da wäre man bei dem zentralen Anliegen von Hinze und dem von ihm zitierten Otto Kernberg. Hinze, wie viele andere auch, macht keinen Unterschied zwischen Einführung, Begleitung, Intervention, Deutung und Unterbrechung. Lehre, die Hinführung des Lehrlings zur sicheren »Überzeugung von der Existenz des Unbewußten«, ist nicht zu verwechseln mit etwas, das gelehrt wird. Freuds von Hinze erwähnter Vorschlag einer periodisch alle fünf Jahre aufzunehmenden Analyse habe »später keinen Niederschlag in psychoanalytischen Ausbildungsgängen gefunden« (S. 143). Punkt.
Immerhin wird die Entwicklung in Frankreich nach 1945 als Möglichkeit referiert: »Die dort vorgenommene Entkoppelung der persönlichen Analyse des Kandidaten von seiner Ausbildung lässt sich rein psychoanalytisch diskursiv begründen und diskutieren.« (S. 144) Daraus folgt nichts. – Der Candidus, jemand, der sich um ein Amt bewarb, trug in Rom eine weiße Toga. Bei Wahlen mussten auch die Adligen eine weiße Toga ohne roten Streifen tragen, um die Chancengleichheit herzustellen. – Die Institution Lehranalyse ist trotz der These von Hanns Sachs – »Wie man sieht, braucht die Analyse etwas, was dem Noviziat der Kirche entspricht« (S. 146) – nicht gleichzusetzen mit dem Noviziat. Hinz fährt fort: »Dennoch: Vergleiche wie die von Sachs weisen oft nicht nur auf oberflächliche Ähnlichkeiten hin, sondern beruhen auch auf tieferliegenden Verwandtschaften.« (S. 146)
Kontrollanalyse
Die Geschichte des zweiten Elements der nach Eitingon benannten Form der Ausbildung, die Kontrollanalyse, die durchgehend im Buch Supervision genannt wird, stellt Gisela Grünewald-Zemsch vor. Sie stellt noch genauer zu befragenden Punkte einer wichtigen Praxis zwischen Analyse, Forschung, Aneignung von Wissen, »das immer auch ein Un-Wissen ist« (S. 155), in den Raum: Weiterentwicklung durch die Herausforderungen der Praxis und die jeweiligen biographisch gewordenen Eigenarten der Analytiker. Es wird deutlich, dass in der Kontrollanalyse viele Potenziale stecken, dass es sich um ein Dispositiv zwischen Analyse, ersten Berufserfahrungen, Verhältnis zwischen den Generationen, Forschungsinstrumentarium handeln könnte, dass aber eine große Herausforderung darin liegt, die Kontrolle, im ursprünglichen Sinne des Wortes als nochmaliges Artikulieren, eine Rolle, die das, was in der einen Rolle verzeichnet ist, noch einmal anders sagt, dadurch zu verderben, dass sie in einem alltäglicheren Sinne der Kontrolle als Beherrschung geopfert wird. Wenn der Kontrollanalytiker als ›Agent eines Instituts‹ über Entscheidungsbefugnisse verfügt, was den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung angeht, wird es eng.[49] Ein Großteil der Transparenzforderung stammt von Kandidaten, wie es heißt, aus der Situation der Abhängigen, weniger aus einem Forschungsinteresse. Es sollen die Kriterien klar sein, nach denen die Arbeit in der Supervison vonstatten geht und die Kandidaten bewertet werden. So formuliert, ist schon akzeptiert, dass bewertet wird und werden kann.
Vielleicht wäre es konsequent aus dem Überblick, den Grünewald-Zemsch gibt, die Supervisionen in der Ausbildung an Instituten von außen zu supervidieren, jedenfalls damit systematisch zu experimentieren. Ein fiktives und dadurch sehr zutreffendes Beispiel (S. 165ff) aus ihrer Forschung zeigt, wie hoch der Druck in der Ausbildung werden kann, nicht zu versagen, bei den Supervidierten und nicht weniger bei den Supervisoren. Scham und Aggressivität seien Folgen einer zu sehr als Überwachung, einer als richtig und erfolgreich unterstellten Psychoanalyse. Sie nennt zum Schluss die psychoanalytische Ausbildungssupervision einen Ort der Verwicklungen (S. 167). Das klingt nach Leben.
Sehnsucht nach systematischem Unterricht
Eva Schmid-Gloor berichtet über die »dritte Säule« des Eitingon-Modells. Sie sieht die theoretische Ausbildung geprägt von einer Sehnsucht nach systematischem Unterricht. Neben der therapeutischen Orientierung stellt sie ein historisch gewachsenes Interesse an geisteswissenschaftlichen Kursen (!) fest. Darin werden die Künste gleich integriert im Modus der Anwendung von Psychoanalyse, nicht umgekehrt als Befragung der Psychoanalyse.
Nirgendwo in der Bestandsaufnahme wird die Produktivität der Naturwissenschaften für die Bildung des Analytikers erwähnt. Sie fragt nach den impliziten und expliziten Lernzielen und bedauert, dass Lehre offenbar nach sehr individuellen Eigenarten der Lehrenden durchgeführt wird. Sie wünscht, dass Übertragungsbeziehungen auch in die theoretische Ausbildung einbezogen werden. Also doch die individuellen Eigenarten?
»›Mörderischen‹ Gewalt der ersten Analytiker«
Serge Frisch beginnt sein Statement mit der starken Aussage: »Die Ausbildung von Psychoanalytikern kann nicht außerhalb der von der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung (IPV) aufgestellten Kriterien besprochen werden« (S. 185). Dieser Satz steht eigentlich als Motto über der gesamten Dokumentation. Er ist offenbar nicht als Vorschrift gemeint, sondern eher als ein zu überwindender Start – jedenfalls wünscht der Rezensent das so.
Frisch erinnert an »das Verschwinden unserer jüdischen Kollegen« in der Vorkriegszeit in Berlin. Nicht dass die Psychoanalyse in Deutschland die Ermordung der Juden hätte verhindern können, aber fragen kann man schon, wie es zur angeblichen Rettung der Psychoanalyse durch den Ausschluss der jüdischen Mitglieder kam, ob der Umgang nicht auch mit dem Unverständnis dessen, was da gerettet werden sollte, zu tun hat. Umso mehr, als Frisch diese Ausschlüsse mit historisch früheren gewagt in Zusammenhang stellt:
»Es ist zweifellos der ›mörderischen‹ Gewalt dieser ersten Analytiker um Freud, die andersdenkende Kollegen wie Adler, Jung und einige andere ausschlossen, zu verdanken, dass sich die freudianische Psychoanalyse entwickeln konnte und nicht durch vielfältige Einflüsse abstumpfen oder ›verwässert‹ wurde.« (S. 187)
Frisch lobt an der Eitingon-Ausbildung, dass sie Laien zuließ. Eitingon habe »1925 die Internationale Unterrichtskommission (IUK) gegründet, [und jetzt kommt eine seltsame Datierungshilfe; KJP], das heißt zwei Jahre, nachdem Freud an Krebs erkrankte« (S. 188). Frisch skizziert dann kurz, wie die American Psychoanalytic Association versuchte, Macht über die IPV zu erlangen, inklusive des Ausschlusses von Laien. Dazu gehöre die »Lüge« der IPV bis 2001, dass es eine einheitliche Ausbildung gäbe. Sie war, so zitiert er Widlöcher[50], »zweifellos moralisch nicht zu rechtfertigen, aber vor allem ungesund für das Leben der Institution« (S. 190).
In Frankreich hätten zwei Revolutionen stattgefunden. Lacan rüttelte »die schlafende analytische Welt mit seinen verkürzten Analysestunden auf« (S. 190), deren Zweck es war, nur so kann Frisch das offenbar in sein Denken einordnen, »viele Kandidaten in Analyse zu nehmen, um so größeren Einfluss in seiner Gesellschaft zu erringen und [?] ein ›Zurück‹ zu Freud und seiner Metapsychologie zu beanspruchen« (S. 190).
»Großvaterklausel«
Der Mai 1968 habe sodann auch die psychoanalytischen Institutionen in Frankreich »tief erschüttert«. Der Status des »Lehranalytikers« wurde auf Betreiben von Laplanche und Pontalis abgeschafft – dazu hatten sie sich offenbar von Lacan anregen lassen –, die Analyse kann von da an vor der eigentlichen Ausbildung stattfinden, um die Unabhängigkeit des Kandidaten von der Institution zu fördern. Die Ausbildung endet mit einem Gespräch, ähnlich der Lacanschen passe, nicht wie in Deutschland mit einer Prüfung. Das führt zu enormen Schwierigkeiten in der IPV, die 1973 unter der Präsidentschaft von Lebovici durch eine »Großvaterklausel« nach dem Modell des 15th Amendment (1870) zur amerikanischen Verfassung gegen die Diskriminierung von Schwarzen und anderen rassischen Minderheiten beim Wahlrecht umgangen wurden. Und das ging so: Um den Weißen den Machterhalt zu gewährleisten, hatten einige Staaten eine poll tax (Kopfsteuer) eingeführt. Nur wer die hohe Steuer zahlte, erlangte das Wahl- und Stimmrecht. Entscheidend war aber: Jeder, dessen Vater oder Großvater in einem bestimmten (vor der Sklavenbefreiung liegenden) Jahr in diesem Staat wählen durfte, durfte steuerfrei wählen. – Übersetzt hieß das wohl aus Sicht der IPV für die Psychoanalyse in Frankreich und in ähnlichen Fällen: Es gab in den Anfängen der Analyse in Frankreich richtige Lehranalytiker, dies vererbt sich. Und die bestehenden Vereinigungen müssen nicht den Preis einer Neuaufnahme zahlen mit den notwendigen Überprüfungen.
»Wie wir wissen, kann die Institution einer der besten Widerstände gegen die Psychoanalyse sein!« (S. 193), schreibt Frisch und empfiehlt wenig verblümt das »französische Modell«.
100 Jahre
Einen anderen Aspekt dieser Schwierigkeit bespricht Angelika Staehle: Die extreme Spannung zwischen einer zentralistischen Haltung und der Vereinheitlichung der Ausbildung vs. Streben nach Autonomie und Gestaltung. Schon im historischen Rückblick zeigt sich, dass die Einheitlichkeit der Ausbildung, als immer noch hintergründiges Ziel, schon immer eine Illusion war. Staehle weiß von mindestens 24 verschiedenen Modellen. Dabei zeichne sich die deutsche Version als eine zielgerichtete Ausbildung für eine Profession aus, die französische als Lernen aus der analytischen Erfahrung. Es bleibt »Ambiguitätstoleranz als zentrale Tugend des Analytikers« (S. 203), die Differenzen in den Ausbildungsmodellen sollen als Quelle der Inspiration und der Stärke gesehen werden, allerdings »innerhalb der IPV« (S. 204).
Kandidatenperspektive
Im abschließenden Beitrag aus Kandidatenperspektive von Artur Sousa wird einer vierten Säule der Ausbildung das Wort geredet: »Erwerb der Fähigkeit, in Gruppen zu arbeiten und mit Kollegen Erfahrungen zu teilen« (S. 208). Von einem Wunsch nach Wandel, von anderen Ideen, von Kritik ist ansonsten nichts zu vernehmen. Aber vielleicht ist ja die Überwindung des individualistischen Blicks in der Konsequenz doch eine sehr radikale Änderung für Theorie und Praxis der Psychoanalyse.
[1] https://www.risszeitschriftfuerpsychoanalyse.org/
[2] Vgl. Rouzel, Joseph: Letzlich, es gibt nur das, das soziale Band, in: RISS – Zeitschrift für Psychoanalyse. Freud – Lacan, 2012, Heft 77, S. 29–43
[3] Meine Assoziation springt zu Loos, Adolf: Ornament und Verbrechen (1931), hg. von Peter Stuiber, Wien 2012, Metroverlag.
[4] »SPIEGEL: Herr Professor, die Allgemeinen Ortskrankenkassen haben sich vor einigen Wochen bereit erklärt, künftig die Kosten für sogenannte große Psychotherapie zu übernehmen. Mit dem Krankenschein auf die Couch des Psychoanalytikers — sehen Sie darin einen späten Sieg Sigmund Freuds in Deutschland?/ MITSCHERLICH: Ja. Allerdings ist noch offen, wie das nun in der Realität aussehen wird. Man muß fragen, erstens: Wer werden diese Behandler sein, die in den Genuß des Krankenkassenhonorars kommen? Werden das Psychoanalytiker mit internationalem Ausbildungsstandard sein — die, wie Sie wissen, in unserem Land überaus rar sind?« Mitscherlich, Alexander: »Teufel noch mal, das haben sie nicht gern« (Interview), in: Der Spiegel, 1962, 52, online: https://www.spiegel.de/kultur/teufel-noch-mal-das-haben-sie-nicht-gern-a-06bb6863-0002-0001-0000-0000461650791962 [06.06.2022]
[5] Für Alexander Mitscherlich war selbst eine Lehranalyse ein schwieriges Unterfangen. Er wollte sich offenbar dem zunächst nicht unterziehen. »Mitscherlich wollte und glaubte, dass es ausreicht, wenn er und seine Mitarbeiter der DPV beitreten. Es fiel ihm schwer zu akzeptieren, dass die DPV auf einer eigenen Analyse mit einem von der IPA anerkannten Ausbildungsanalytiker bestand. 1956 wurde Mitscherlich Mitglied der DPV und holte diese Forderung 1958 nach, als er für ein Jahr zu Paula Heimann nach London ging.« Vgl. Brecht, Karen: In the Aftermath of Nazi-Germany: Alexander Mitscherlich and Psychoanalysis – Legend and Legacy, in: American Imago. The Johns Hopkins University Press Stable, 1995, 52. Jg., Heft 3, S. 291–312, hier S. 301, online: https://www.jstor.org/stable/26304611 [27.10.2022]. Zustimmend in Bezug auf die »mangelnde formale Ausbildung«: Rabinbach, Anson: Response to Karen Brecht, »In the Aftermath of Nazi Germany: Alexander Mitscherlich and Psychoanalysis – Legend and Legacy«, in: ebd., S. 313–328, hier S. 313
[6] Safouan, Moustafa: Die Übertragung und das Begehren des Analytikers, Übers.: G. Schnedermann, Würzburg 1997, Königshausen & Neumann, S. 144: Safouan betont, dass das Begehren des Analytikers durch eine Begrenzung wirkt: »Seine Begrenzung ist eine innere: diejenige, die es im geeigneten Moment korrekt zwischen Narzißmus und Begehren […] wählen läßt.«
[7] »Ich sage mir oft: Nur nicht heilen wollen, lernen und Geld erwerben! Das sind die brauchbarsten bewußten Zielvorstellungen.« Freud, Sigmund; Jung, Carl Gustav: Briefwechsel, hg. von W. Mcguire u. W. Sauerländer, Frankfurt am Main 1974, Fischer, Brief vom 25. Januar 1909, S. 224.
[8] »Dieser ›freiwillige‹ Austritt aller jüdischen Psychoanalytiker sei notwendig gewesen, um die nun ›arische‹ DPG zu retten. Es folgten weitere taktische Manöver. Anfang der 1950er Jahre fand der jüdische Emigrant Fromm seinen Namen nicht mehr in der IPV-Mitgliederliste. Es wurde ihm angeboten, sich noch einmal zu bewerben, wenn auch seine Position doch zwischenzeitlich – hier ähnelt sein Schicksal demjenigen Reichs – auch nicht mehr mit Freud vereinbar sei.« Kaufhold, Roland; Hristeva, Galina: »Das Leben ist aus. Abrechnung halten!« – Eine Erinnerung an vertriebene jüdische Psychoanalytiker unter besonderer Berücksichtigung von Wilhelm Reichs epochemachenden Faschismus-Analysen, in: Psychoanalyse im Widerspruch, 2021, 33. Jg., Heft 66, S. 7–66, hier S. 49. »›Konservative‹ Funktionäre wie Boehm, Müller-Braunschweig und Jones betrieben und legitimierten daraufhin Standespolitik. Diese lief in der Praxis darauf hinaus, die jüdischen Kollegen aus den Institutionen hinauszudrängen bzw. hinauszuwerfen; bei einigen von ihnen versuchten die nun ›judenfreien‹ psychoanalytischen Institutionen sogar, ausstehende Mitgliedsbeiträge sogar noch im Exil einzutreiben. Deren Verfolgung und Vertreibung – ca. 30 Psychoanalytiker und Widerständler wurden ermordet, ihr Leben endete in Auschwitz, in Theresienstadt und in weiteren deutschen Vernichtungslagern […] – wurden als ein notwendiges ›Übel‹ betrachtet, um die Psychoanalyse zu ›retten‹. Einige Autoren schreiben dieses uns befremdende Mantra bis heute fort.« Ebd. S. 12. Siehe auch Lohmann, Hans-Martin; Rosenkötter, Lutz: Psychoanalyse in Hitlerdeutschland. Wie war es wirklich?, in: Psyche. Zeitschrift für Psychoananalyse und ihre Anwendungen, 1983, 37. Jg., Heft 12, S. 1107–1115 und dies. (Hg.), Psychoanalyse und Nationalsozialismus – Beiträge zur Bearbeitung eines unbewältigten Traumas, Frankfurt am Main 1984, Fischer.
[9] Ich bin schon lange auf der Suche nach einem Ausdruck, der eine (milde) institutionalisierte Zusammenarbeit bezeichnet. Vereinigung ist gerade im psychoanalytischen Bereich meist schon der Eigennamen eines Vereins, Assoziation ebenso, Gemeinschaft ist zu fest und belastet. Und so kam ich zu https://www.dwds.de/wb/dwb/gesellung und https://books.google.de/books?id=hsDwBgAAQBAJ&pg=PA29&lpg=PA29&dq=gesellung&source=bl&ots=NX8yeAnicT&sig=ACfU3U1oLskf0MHghcflANnGd1jhXK23Xg&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiLs53ur6j5AhW1X_EDHXY3CmUQ6AF6BAgSEAM#v=onepage&q=gesellung&f=false [10.08.2022]
[10] »Dagegen sehe ich, daß die Differenz zwischen uns sich auf ein Kleinstes, ein Detail der Technik, zuspitzt, das eine Erörterung wohl verdient. Sie haben kein Geheimnis daraus gemacht, daß Sie ihre Pat. (ienten) küssen und sich von ihnen küssen lassen; auch hatte ich dasselbe schon von meinen Patienten (via Clara Thompson) gehört. Nun scheiden sich, wenn Sie ausführlichen Bericht über Technik und Erfolge geben, für Sie zwei Wege. Entweder Sie teilen dies mit, oder Sie verschweigen es. Letzteres, wie Sie sich denken können, ist unwürdig. Was man in der Technik tut, muß man auch öffentlich vertreten.« Falzeder, Ernst; Brabant, Eva (Hg.), Sigmund Freud / Sándor Ferenczi. Briefwechsel, Band III/2, 1925–1933, Wien 2005, Böhlau, S. 272f.
[11] Siehe die unten noch erwähnte Großvaterklausel.
[12] Im Sinne des Grundgesetzes: Alle Gewalt geht vom Volke aus. Die Feststellung des Bestehens einer Prüfung, der Aufnahme in einen Ausbildungsgang ist eine solche Gewaltanwendung.
[13] Hinweise auf eine solche Auseinandersetzung lassen sich in Alfred Ernest Jones Freud-Biografie finden, wie Zaretsky schreibt: »Jones’ Biographie, die Anna Freud der ›würdigen Tochter eines unsterblichen Mannes‹ gewidmet war, erschien ab 1954. So mächtig war Freuds Bild, daß manche Analytiker den Jones unterstellten Prozeß der Reifung in den letzten Jahrzehnten seines Lebens darauf zurück führten, daß er im Material versunken sei. Jones suchte den wissenschaftlichen Charakter der Analyse hervorzuheben, betonte daher Freuds Verhältnis zu Brückes Materialismus und spielte demgegenüber Freuds Teilnahme an den philosophischen Vorlesungen von Franz Brentano herunter. Noch immer kämpfte Jones mit den Nachwirkungen eines charismatischen Umbruchs, deshalb schrieb er auch den Erfahrungen des Männerbunds keine große Bedeutung zu, ignorierte alle Verbindungen, die es zwischen Analyse und Politik gegeben hatte, beglich alte Rechnungen mit Rank und Ferenczi und gab so ein Beispiel für das, was Peter Homans die ›Urangst‹ der Psychoanalyse nannte – nämlich, daß sie als eine Religion mißverstanden werden könnte.« Zaretsky, Eli: Freuds Jahrhundert, Wien 2006, Zsolnay, S. 418
[14] Vgl. Psychanalyse, Inter-Associatif Européen de (Hg.): Une passe sans école mais pas sans adresse, Paris 2010, Éditions des crépuscules. Und zum Überblick vgl. Tardits, Annie: Les formations du psychanalyste. Ramonville Saint-Agne 2000, Erès
[15] Gur, Batya: Denn am Sabbat sollst du ruhen, Übers.: M. Zibaso. München 1994, Goldmann. Siehe auch: https://www.buechernachlese.de/archiv/uk_gur_batya_sabbat.html [27.08.22]
[16] Mehr dazu weiter unten.
[17] Kernberg, Otto F.: Dreißig Methoden zur Unterdrückung der Kreativität der Kandidaten der Psychoanalyse, in: Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen, 1998, Heft 3, S. 199–213; Cremerius, Johannes: Für eine psychoanalyse-gerechte Ausbildung!, in: ebd., 1987, 41. Jg., Heft 12, S. 1067–1096; Wiegand-Grefe, Silke: Die Destruktivität in der psychoanalytischen Ausbildung – Plädoyer für eine Ausbildungsreform, in: Forum der Psychoanalyse, 2004, 20. Jg., Heft 3, S. 331–350; Bohleber, Werner: Gewalt in psychoanalytischen Institutionen, in: Luzifer-Amor, 2000, Heft 13, S. 7–15; Dahmer, Helmut, u.a.: Zur gegenwärtigen Situation der Psychoanalyse. Memorandum Kritische Freunde der Freudschen Psychoanalyse, in: Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendung, 2014, 68. Jg., Heft 5, S. 477–484
[18] »Da diese Anstalten ihren Zweck indess nur erreichen können, wenn jede, soviel als immer möglich, der reinen Idee der Wissenschaft gegenübersteht, so sind Einsamkeit und Freiheit die in ihrem Kreise vorwaltenden Principien. Da aber auch das geistige Wirken in der Menschheit nur als Zusammenwirken gedeiht, und zwar nicht bloss, damit Einer ersetze, was dem Anderen mangelt, sondern damit die gelingende Thätigkeit des Einen den Anderen begeistere und Allen die allgemeine, ursprüngliche, in den Einzelnen nur einzeln oder abgeleitet hervorstrahlende Kraft sichtbar werde, so muss die innere Organisation dieser Anstalten ein ununterbrochenes, sich immer selbst wieder belebendes, aber ungezwungenes und absichtsloses Zusammenwirken hervorbringen und unterhalten.« Humboldt, Wilhelm von: Ueber die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin (1809/10), in: Flitner, Andreas; Giel, Klaus (Hg.): Schriften zur Politik und zum Bildungswesen, Bd. 4, Darmstadt 1969, WBG, S. 253–265, hier S. 253
[19] Derrida, Jacques: Die unbedingte Universität, Frankfurt am Main 2001, Suhrkamp, S. 15–36, insb. S. 22
[20] Valentin, Karl: Ich nehm den Fisch und tu ihn ertränken – Monologe eines gescheiterten Musikclowns (1908–1912), in: Schulte, Michael (Hg.): Das große Karl-Valentin-Buch, München 1974, Piper, S. 13
[21] Schon damit hatte einer der Protagonisten der DPV, der später ein Ausbildungsinstitut in Frankfurt am Main gründete, große Schwierigkeiten. Siehe Lockot, Regine: DPV und DPG auf dem dünnen Eis der DGPT – Zur Beziehungsgeschichte von Deutscher Psychoanalytischer Vereinigung (DPV) und Deutscher Psychoanalytischer Gesellschaft (DPG) innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Psychotherapie und Tiefenpsychologie (DGPT) bis 1967, in: Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen, 2010, 64. Jg., Heft 12, S. 1206–1242, hier S. 1214ff.
[22] Freud, Sigmund: Die Frage der Laienanalyse (1926), in: Studienausgabe, Ergänzungsband, Frankfurt am Main 1975, Fischer, S. 271–349, hier S. 339
[23] Stern, Anne-Lise: Früher mal ein deutsches Kind – Auschwitz, Geschichte, Psychoanalyse, mit einem Vorwort von Nadine Fresco und Martine Leibovici, Übers.: E. Reinke, Gießen 2020, Psychosozial, S. 181f.
[24] Siehe hierzu Brecht: In the Aftermath of Nazi-Germany
[25] Freud, Sigmund: Abriß der Psychoanalyse (1938), in: Gesammelte Werke, Bd. XVII, Frankfurt am Main 1976, Fischer, S. 63–138, hier S. 105
[26] Kaufhold/Hristeva: »Das Leben ist aus. Abrechnung halten!«, S. 11
[27] Die Webseite https://mitfreudinberlin.jimdofree.com [27.07.2022] hat als Hintergrund das bombardierte, ruinierte Berlin. Das war 12 Jahre, nachdem die Juden, die auch Analytiker waren, Berlin verlassen und zuvor aus ihrer psychoanalytischen Gesellschaft austreten mussten. Welche Aussage soll mit diesem Rebus erraten werden?
[28] Kaufhold/Hristeva: »Das Leben ist aus. Abrechnung halten!«, S. 12
[29] »Im November 1935 schrieb Jones an Freuds Tochter Anna Freud: ›All Jews have to resign from Berlin Society. Deplorable as it would be, I should still say that I prefer Psychoanalysis to be practiced by Gentiles in Germany than not at all and I hope you agree.‹ Um die ›Integration‹ der Gesellschaft zu erleichtern, trafen sich Jones, Brill, Boehm und Müller-Braunschweig mit Göring.« Zaretsky: Freuds Jahrhundert, S. 325.
[30] Dies unbeschadet der Fehleinschätzungen von Freud u.a. bezüglich des Nationalsozialismus. Siehe hierzu Kaufhold/Hristeva: »Das Leben ist aus. Abrechnung halten!«, S.54. Und vgl. auch Freuds Versuche, sich die Psychoanalyse als neutral vorzustellen, beschrieben in: Kaufhold, Roland; Wirth, Hans-Jürgen: Sigmund Freuds Weg ins Exil, in: Tribüne, Heft 1, S. 158–171, online: https://www.hagalil.com/archiv/2008/11/freud.htm [27.07.2022]
[31] Das reicht bis hin zum übergriffig festgestellten szientifischen Selbstmissverständnis der Psychoanalyse durch Habermas. Siehe hierzu Habermas, Jürgen: Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main 1968, Suhrkamp, S. 300ff. Habermas kennt die Dimension eines unkalkulierbaren Begehrens nicht. Was er, wie auch Lorenzer, auf den er sich bei der Rekonstruktion verdorbenen Textes stützt, nicht sehen, ist die Dynamik der Übertragung, die in jedem Moment einen ursprünglich zu rekonstruierenden Sinn wieder aufs Neue in Bewegung bringt. Eine solche Hermeneutik bleibt naiv.
[32] Matthias Heinrich Göring war ab 1936 zusammen mit C. G. Jung Mitherausgeber des Zentralblattes für Psychotherapie und ihre Grenzgebiete. Siehe Klee, Ernst: Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945, Frankfurt am Main 22005, Fischer, S. 190
[33] In Deutschland ist, soweit mir bekannt, nur die Bundeswehruniversität in Hamburg »ausfinanziert«.
[34] Bernfeld, Siegfried: Über die psychoanalytische Ausbildung (1952), in: Psa. Info, 1962, Heft 19, S. 1–27, und Bernfeld, Siegfried: Über die psychoanalytische Ausbildung (1952). In: Psyche, 1984, 38. Jg., Heft 5, S. 437–459
[35] Bernfeld hatte schon am Lehrprogramm des Berliner Instituts mitgearbeitet. Das findet keine Erwähnung im vorliegenden Buch. Siehe: Kaufhold, Roland: Siegfried Bernfeld: Psychoanalyse, Pädagogik und Zionismus,2010, online: https://www.hagalil.com/2010/05/bernfeld/ [24.07.2022].
[36] Mehr dazu siehe https://mitfreudinberlin.jimdofree.com/gedenktafeln-mit-freud/siegfried-bernfeld/#SB_Laienanalytiker [01.06.2022]
[37] Adler, Nathan: Siegfried Bernfeld in San Francisco: a Conversation with Nathan Adler, in: Fort Da – The Journal of the Nothern Cliforrnian Society for Psychoanalytic Psychology, 2012, XVIII. Jg., Heft 1. Im Wesentlichen bestätigt dies Hermanns, Ludger M.: Der »komplizierte Fall San Francisco« oder »Psychoanalyse ist hier eine Laiensache« – Siegfried Bernfelds Brief an Anna Freud aus dem Jahre 1937, in: Fallend, Karl (Hg.): Siegfried Bernfeld oder die Grenzen der Psychoanalyse, Basel; Frankfurt am Main, Stroemfeld 1992, S. 290–299, S. 292f.
[38] Freud, Sigmund: Die Endliche und die unendliche Analyse (1937), in: Studienausgabe, Ergänzungsband, S. 351–392, hier S. 388
[39] Ders.: Ratschläge für den Arzt bei der psychoanalytischen Behandlung (1913), in: ebd., S. 169–180, hier S. 176f.
[40] Ders.: Die Endliche und die unendliche Analyse, S. 388
[41] Vgl. z.B. Lemérer, Brigitte: La passe, entre héritage et invention – Transmission de la psychanalyse et formation des analystes, in: essaim. Revue de Psychanalyse, 2003, Heft 11, S. 179–198; Mendes Dias, Mauro: La passe: entre la fin d`analyse et le désir du psychanalyste – Une question pour la formation du psychanalyste, in: ebd., S. 101–108; Millot, Catherine: Lehre und passe, in: Brief der psychoanalytischen Assoziation: Die Zeit zum Begreifen – Aktuelle Probleme der Analytikerausbildung, 1997, Heft 19/20, S. 5–24; Porge, Érik: Nommer quoi? À propos de la nomination dans la passe, in: essaim. Revue de Psychanalyse, 2003, Heft 11, S. 39–56, 2003; Inter-Associatif Européen de Psychanalyse (Hg.): Une passe sans école
[42] Im hier besprochenen Buch zitiert aus King, Pearl; Steiner; Ricardo (Hg.): The Freud Klein Controversies 1941–45. London 1991 (2000), Routledge, S. 672
[43] Vielleicht steht ein Psychoanalytiker besser außerhalb der Norm, sowohl auf dem Weg zur Psychoanalyse wie auch zu Beginn seiner Tätigkeit als Analytiker. So berichtet Georg Bruns (Bruns, Georg: Alexander Mitscherlich und seine Beziehung zur DPV. In: Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen, 2009, 63. Jg., Heft 2, 2009, 153–167, S. 12): »Mitscherlich war hinsichtlich seiner politischen, akademischen und gesellschaftlichen Verbindungen und hinsichtlich seines Werdeganges ein Sonderfall in der DPV, aber fast alle, die in den 50er Jahren in die DPV eingetreten sind, haben ungewöhnliche, sehr individuelle Wege zur Psychoanalyse gefunden. Besonders war auch seine sozialpsychologische Denkweise. Aber war er damit ein Außenseiter innerhalb der DPV, wie Dehli meint, weil die DPV ›seine Rolle als engagierter Gesellschaftskritiker und Person des öffentlichen Lebens skeptisch beäugte? (Dehli 2007, S. 211)«. Dehli, Martin: Leben als Konflikt, Göttingen 22007 Wallstein. Mitscherlich machte eine Lehranalyse während eines Jahres.
[44] Auswirkungen dieser Auseinandersetzungen finden sich dann ab Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts in Österreich und Deutschland. Siehe hierzu: Seitter, Walter; Ruhs, August: Interview: Lacan in Wien, in: Diskurier. Text, Klinik, Deutung, 1992, Heft 1, S. 71–73, 1992 u. Witte, Ilsabe; Schrübbers, Christiane: Über die Sigmund-Freud-Schule Berlin, in: Berliner Brief, 2004, Sonderheft III: Der Rede Wert, S. 75–92
[45] Freud, Sigmund: Wege der psychoanalytischen Therapie (1919). In: GW XII, S. 183–194, hier S. 192f.
[46] Vgl. hierzu Ash, Mitchell G. (Hg.): Psychoanalyse in totalitären und autoritären Regimen, Frankfurt am Main 2010, Brandes & Apsel, S. 47ff. Und auch die Behauptung Annemarie Dührssens, das Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem Göring-Institut sei langfristig für die deutsche Psychoanalyse von Vorteil gewesen, geht in diese Richtung. Vgl. zudem die Rezension von Hristeva, Galina: Hitlers reinigende Feuer, online: https://literaturkritik.de/id/14945 [04.06.2022]
[47] Freud: Die Frage der Laienanalyse, S. 283f.
[48] Ebd., S. 284
[49] Ein anderer Aspekt der Kontrollanalyse betreffend das, was die Gegenübertragung genannt wird, wird hier nicht erwähnt. Siehe dazu Deutsch, Helene: Kontrollanalyse (1927/1935),hg. von Claus-Dieter Rath, in: Luzifer-Amor. Zeitschrift zur Geschichte der Psychoanalyse, 2008, Heft 42, S. 37–48; Rath, Claus-Dieter: Kontrolliert die Psychoanalyse?! Eine Skizze, in: Decker, Oliver; Türcke, Christoph (Hg.): Kritische Theorie – Psychoanalytische Praxis, Gieße 2007, Psychosozial-Verlag, S. 147–167; Rath, Claus-Dieter: Psychoanalysieren unter Kontrolle. Helene Deutschs Beitrag zu den Fragen der Kontrollanalyse im Kontext der zeitgenössischen Diskussion, in: Luzifer-Amor, 2008, Heft 42, S. 8–36
[50] Widlöcher, Daniel: Éthique et querelles dans les institutions psychoanalytique, in:Bouhsira, Jacques; Dreyfus-Asséo, Sylvie; Durieux, Marie-Claire; Janin, Claude (Hg.): Transgression, Monographies et Débats de psychanalyse, Paris 2009, PUF, S. 199–207
Hamacher, Werner: Mit ohne Mit. Zürich 2021, Diaphanes (transpositionen), rezensiert von Martin A. Hainz
Die Differenz ist bekannt: Dekonstruktivismus ist als Verfahrensweise, die aus der Dekonstruktion erlernte Techniken anwendet, im Moment dieser Voraussetzungen schon nicht mehr Dekonstruktion. Selbst der Satz, die Differenz zwischen beiden sei bekannt, ist insofern unhaltbar, Dekonstruktion scheint sich vielmehr von sich selbst zu unterscheiden. Das ähnelt der Struktur der Psychoanalyse, die nicht behauptet, sie wisse, was sie tue – sie ist vielmehr die Achtsamkeit für Dysfunktionen des Bezeichnens und Erklärens dessen, was der Mensch sei, denke, wolle oder erleide und erlitten habe.
Hamacher arbeitet in dieser Region, wenn es eine ist. Er arbeitet an der »inexpliziten Philosophie« (S. 7), die aber entfaltet Technik würde, womit es um ein Entfalten und etwas, das noch immer zu entfalten sei, geht: an der Philosophie, aber mit ihr, da sie das unentfaltete (oder schlicht eingefaltete, auffaltbar scheinende) Entfalten ist.
Auch das entspricht der Idee der Psychoanalyse: ums Unerhörte geht es, um das, was aufgrund einer Ungenauigkeit unvernommen blieb und nun in diesem Sinne unerhört das Unerhörte des Nicht-Hörens aufdeckt. Rezensieren lässt sich das kaum, das ist die sofortige Verlegenheit auch bei Hamachers Werk. Man kann nur einige seiner Manöver im Text zeigen, in seinem und in dem Text, welcher der jeweils gelesene wäre. Hamacher schreibt sich aus Traditionen der Hellhörigkeit her, aber er schreibt auch gegen ein Weghören an.
Hamacher beobachtet und beschreibt, was er tut, indem er diese Rekonstruktionen von Unbewusstem – unbewusst Gebliebenem oder Gewordenem – vornimmt. Aber wäre dies eine Technik, wiederholte sie die Schwerhörigkeit. Insofern geschieht eine Analyse dessen, was vorgenommen wird, damit diese Analyse der Analyse möglich ist. Und zugleich ist schon eine erste Analyse eines Sachverhalts doch nie nur die Einladung, es besser zu machen: Das beobachtete Philosophieren ad rem ist ebenso ein Philosophieren, bloß eines, das sich noch weniger als jenes zweite (Meta-)Philosophieren versteht, das auch noch nicht hinreichend versteht, was zu verstehen sein soll …
Vielleicht geht es also um eine »Tauto-Topologie« (S. 13), vielleicht aber auch um deren Gegenteil. Es scheint dabei eine Glaubenssache impliziert zu sein, an der das Geglaubte das (wertfrei) indiskutable Problem ist. Man müsste es diskutabel machen, indem man den Glauben kennt und weiß, inwiefern er das verändert, was als Subjekt womöglich nur sein Objekt denke. Aber das zu glauben – dass man hinter sein Philosophieren denken kann –, bedeutet, selbst die »faktische[n] Inexistenz Gottes« als »Spur von Göttlichkeit zu entdecken« (S. 19), ein Evangelium oder Dysangelium, wenn Philosophie darauf so oder anders basiert.
Gott als Garant einer besten immerhin aller möglichen Welten ist dabei das Problem. Selbst das würde implizieren, dass jener Gott das Leid hörte und abwöge. Mitleidend. Vielleicht müsste man das Mit (mit‑)denken, den Umstand, dass Denken immer diese Spur hat, von sich oder etwas, das seinen Logiken nicht gehorcht. Nancy, auf den Hamacher sich oft bezieht, schreibt von »Beziehung […] im Zentrum des Seins«[2], dass also das, was ist, es ist, indem es nicht vollständig ist. Aber damit ist das, was seine Alterität ist, vor allem seine, weniger dagegen ist diese Alterität wirklich Alterität.
»Selbst-Komplementierung des Mitseins« (S. 30) nennt dies Hamacher. Das Mit »muss leer und kann keine Matrix sein.« (S. 44)
Mit Bataille formuliert Hamacher, es gehe also um ein »Mit des Ohne-Mit« (S. 47), vielleicht um ein Phänomen der Schrift, des Sprechens und Schreibens, das zwischen dem, was es sei, und dem, womit es sei, changiert: »seiner Entsprechung ausgesetzt« (S. 49). Schrift ist »Rückschrift« oder »Entschreibung (des-écriture)«, so Hamacher, sobald schreibend »gedacht wird, wird auch entdacht.« (S. 49) Immer wieder geht es ums Fixieren dessen, was eine Schrift sei. Nie aber gibt es diesen Rückzugsort, wo das Sein und die Signifikanten zur Ruhe kommen, wo das Insignifikante nicht stört, das – siehe oben – das Unerhörte der Fixierung ist. Man weiß, dass das Übrige, das man als solches erledigt zu haben vermeint, wiederkehrt, sich nicht gefallen lässt, als das Übrige genannt und nicht genannt zu sein. Es verlangt Beziehungsarbeit, diese Beziehungsarbeit, die eine Überforderung ist: »Kalkül ohne Ende« (S. 111).
»Licht – oder Ich – wäre das Geschehen des Unterscheidens, das ein von ihm Unterschiedenes entlässt.« (S. 123) Statt einer Beherrschung geht es immer wieder um eine Entherrschung, die verstünde, aber eben nicht in jener Art des Begreifens, die be- und zugreift. Und diese misslingt, aber auch das nur vielleicht. Vielleicht glückt eine »›simili-‹ und ›semi-transzendental‹« (S. 129) verfahrende oder sich aktualisierende Art des Denkens …? Die Formulierung, es bestehe im Denken ein »Perverformativ« (S. 203), findet sich bei Hamacher schon in früheren Texten.
So arbeitet Hamacher am Zukünftigen, an dem, was zu sagen bleibt. Zukunft ist »die nackteste Zukunft« (S. 238), auf sie richtet sich dieses Buch, das in diesem Sinne unbedingt ist. Da ist etwas, das jetzt nichts ist, aber das »Nichts, und dieses zuerst, ist messianisch.« (S. 241) – Und das Nichts kommt, als wäre es wenig, doch ermöglicht es hier alles, in immer neuen Auslöschungen von Voraussetzungen. »Zur Methode: Vergiss das Keine nicht.« (S. 243)
So beginnt nichts, aber so endet auch nichts, das Gespräch, zu dem das Buch anrät, ist und bleibt offen. Selbst da, wo der Tod auftritt, ist die Rede von der »endlosen Mortalisierung« (S. 354), die offenbar paradox einer Unsterblichkeit das Wort redet, die sich Tag für Tag nie ganz beweist, die aber auch nicht widerlegt wird.[3] Das Motiv der Nekyia. Ganz an den Anfang führt nichts, so »referentiell« (S. 362) ist nichts – aber vielleicht ist das auch nur der Standpunkt derer, die das Letzte kennen, »das […] Verschließen des Sinns«[4] zur Präsenz, wo Hamacher der Beweglichkeit das Wort redet. Sie wird erlitten, sie ist Chance, »Ferenz« und »Feranz« (S. 362) …
Hamachers Buch versucht sich verstörend an der »Relation zur Irrelation« (S. 50). Diese Verstörung ist kohärent und deutet – noch verstörender – an, dass sie weder hinreichend verstörend noch ganz kohärent sein muss. Ein Buch wie ein Riss, zur Lektüre empfohlen, zur nie (wie) erstmaligen und nie letztmaligen. Das ist kein Urteil, das ist mehr und weniger als das: Hamachers wegen.
[1] https://www.risszeitschriftfuerpsychoanalyse.org/
[2] Nancy, Jean-Luc: singulär plural sein. Übers.: Müller-Schöll, U., Berlin 2004, diaphanes, S. 124
[3]) Werner Hamachers Andere Schmerzen, 2022 bei diaphanes erschienen, fokussiert hierauf.
[4]) Nancy, Jean-Luc: Entstehung zur Präsenz. Übers.: Vogel, O. In: Hart Nibbrig, Christiaan L. (Hg.). Was heißt »Darstellen«?, Frankfurt a. M. 1994, Suhrkamp, S. 102–106, hier S. 104
Braunstein, Nestor A.: Jouissance. A Lacanian Concept,
Albany 2020, State University of New York Press, rezensiert von Ulrich Hermanns
Jouissance – »Never enjoyment!«
Realisten verstehen unter Genießen vermutlich etwas Flüchtiges, einen angenehmen Zustand, der die Nähe zum Objekt spürbar macht, es jedoch zugleich auf Abstand hält. Möglicherweise mit einer Spur Transzendenz. Eine Identität des Subjekts wird gerade einmal so weit in Frage gestellt, dass sie mit eigenen Bordmitteln und dem sublim anverwandelten Objekt spielerisch wieder hergestellt werden kann. Ästhetische Erziehung des Selbst.
Der 1941 in Argentinien geborene Nestor A. Braunstein ist Arzt, Psychoanalytiker, Professor und Autor. 1974 emigrierte er nach Mexiko. 1990 publizierte er das Buch Goce in Spanisch, eine der ersten systematischen Auseinandersetzungen mit Jacques Lacans Konzept der Jouissance. Mittlerweile lebt der Autor in Madrid. Die Liste seiner Veröffentlichungen ist lang, sowohl Bücher als auch Aufsätze, vorwiegend in Spanisch und Portugiesisch. Vieles ist ins Englische und Französische übersetzt worden, Texte auf Deutsch jedoch fehlen.
Dem Buch Goce erfuhr ein außergewöhnliches Schicksal. 1994 erschien eine französische Übersetzung. Sie wurde 2005 überarbeitet und erweitert. 2006 wurde sie, wiederum revidiert, ins Spanische zurück übersetzt: El Goce: Un concepto lacaniano. Eine portugiesische Fassung kam 2007. Erst 2021 hat Silvia Rosman, die als Professorin an der University of Illinois und Chicago lehrt, das Werk einfühlsam ins Englisch übersetzt: Jouissance. A Lacanian Concept. Dieses Buch möchte ich vorstellen, weil es einige aufschlussreiche, zuvor nicht so prägnant formulierte Feststellungen enthält.
Der Untertitel lautet: A Lacanian Concept, dies ist das eigentliche Bezugsfeld. Dabei gilt dem Autor zufolge: »Goce in Spanish, der Genuss in German, la jouissance in French. Never enjoyment.« (S. 14) Die Gründe für die Absage an enjoyment sind vielfältig. Nicht zuletzt auf Lacans Vorbehalt gründend: » Lalangue, je crois que c’est lalangue anglaise qui fait obstacle. […] Je ne suis pas le premier à avoir constaté cette résistance de lalangue anglaise à l’inconscient.« (R.S.I., Sem XXII, 11. 2. 1975) Widerstand der englischen Sprache gegen das Unbewusste – für den in diesem Feld Arbeitenden nicht pauschal, doch immer wiederkehrend erfahrbar. Nicht ohne Grund brauchte es lange, bis Braunsteins Text mit Silvia Rosmans Hilfe die Hindernisse überqueren konnte.
Die Wurzeln des lacanschen Konzepts von Jouissance macht Braunstein in der Sitzung vom 5. März 1958 in dessen Seminar V, Les formations de l’inconscient, aus. Hier kommt es zur Polarität von le désir und la jouissance, mit der der Herausgeber Jacques-Alain Miller die Sitzung überschrieb. Das engere Bezugsfeld ist hier noch schwach ausgeführt. Was sich im Verlauf der Jahre drastisch änderte. Braunstein interessiert vor allem das Konzept, weniger die historischen Linien. Dabei votiert er für einen drastischen Perspektivwechsel in der psychoanalytischen Arbeit: »Psychoanalytic technique is misguided if it does not take jouissance, rather than pleasure, as the point of departure in the approach to each case.« (S. 41)
Der Aufriss des Werks teilt sich in zwei große Abschnitte: I. Theory und II. The Clinic. Beide sind in je vier Kapitel von etwa gleichem Umfang gegliedert. Sie ergänzen sich in ihren Aussagen.
Der erste Teil wird vor allem durch ausgiebige Bezüge auf Lacan und Freud gestützt, ergänzt durch Literaturbezüge zu Prousts À la recherche du temps perdu. (Kafkas Brief an den Vater wird im zweiten Teil Thema.) Als Bindeglied zwischen Freud, Proust und Lacan erscheint folgender Zusammenhang: »Freud’s and Proust’s searches are one and the same. Lacan’s as well. Jouissance lies in wait of ›fortuitous‹ encounters, ›as if by chance‹.« (S. 167) Ganz so ›zufällige‹ Geschehnisse sind es dann doch nicht, welche Proust die Zeit nicht haben wiederfinden lassen. Nicht weil er sie gar nicht verlor, sondern er stattdessen Jouissance als die Aufhebung von Zeit entdeckte. Damit verbunden, wird auch der Tod bedeutungslos. »Proust does not recover Time at the end of his long itinerary because it is not Time he has lost. […] Instead, Proust finds jouissance, the annulment of Time, synchrony, the closure of the psychic apparatus’ progressive movement.« (S. 163) Braunstein akzentuiert dabei eine ganz besondere Position zur Analyse: »À la recherche du temps perdu is the chronicle of an analysis without an analyst, outside transference.« (S. 163) Eine Analyse ohne Analytiker und Übertragung – Braunstein bejaht diese Möglichkeit ausdrücklich.
Ein ausgiebiger Exkurs zu Michel Foucault in Kapitel 3 unterstreicht vor allem die Rolle der lacanschen Position in aktueller Hinsicht: »Queer theory is threatened by its own success.« (S. 132) »There is no normal or natural relation between the sexes. Their jouissance is not complementary.« (S. 139) »We must understand that queer theory is Lacanian or it is not.« (S. 143) – eine Lanze für Lacan.
Einige prägnante Formulierungen aus dem Teil Theory sollen Braunsteins bemerkenswerte Positionen markieren. »The true substance of the death drive is on the side of jouissance, suffering, exploit, the act.« (S. 46) Dabei stellt sich todestriebliches Leiden, wie in Teil II ausgeführt, als weitgehend unhintergehbar dar. Sogar ein Körper, der pausenloses Leiden durch Spannungen erträgt, kann Jouissance erfahren, welche die Grenzen spürbar macht, die ihr durch die Lust auferlegt sind. Dies sei auch das Ziel der Analyse, nicht aber ein Lustprinzip oder Wohlergehen. (S. 240) Jouissance ist also geschieden von Lust und deren Rolle im Lustprinzip. (S. 85) »Desire does not know itself in the imaginary formation of the phantasm that stages the aspirations to jouissance and, consequently, is another barrier to jouissance.« (S. 86) Begehren sei eine weitere Grenze zum Genießen, wobei die andere die Lust ist – wir erinnern: »never enjoyment« (S. 14). Dagegen gewährt die Sprache Zugang zur Jouissance. »Language is not a barrier to jouissance. On the contrary, it is a device (appareil) for jouissance; it presents and represents this jouissance whose absence would render the universe vain.« (S. 90) Das Subjekt des Genießens wäre in lacanscher Notation ein offenes S, ohne Barre. Eine unaussprechliche Existenz, wobei Lacan selbst eine primäre Jouissance als Ding figuriert. (S. 95)
In Braunsteins Konzept gibt es konsequenterweise auch ein Genießen des Anderen. Es spielt vor allem im klinischen Teil eine Rolle. Doch schon im Teil Theory werden Bilder evoziert, welche die Funktionsweise vor Augen führt:
The subject fades before the jouissance of the Other that appears in multiple ways: as the open jaws of the voracious monster in the nightmare; a devastating or inscrutable destiny; the uncanny noise of a scream that envelops us (the scream of nature that resounds in Munch’s painting, the scream not heard by the characters who turn their backs to the mouth uttering the cry and go on their way); the semblant of jouissance that in the imaginary the neurotic attributes to the black widow and the praying mantis, that ineffable feminine jouissance that is »beyond the phallus« and beyond meaning. The unforgettable jouissance of the Other condemns the sexual relation to nonexistence. (S. 98)
Solch eindringliche Passagen zeigen die Dichte der Konzeption Nestor Braunsteins. Dabei ist es vor allem seine Handschrift, welche das lacansche Konzept sichtbar macht.
Mit der »ineffabile feminine jouissance« wird es Zeit, die Synthesis von insgesamt drei relevanten Zweigen der Jouissance zu skizzieren. Braunsteins Tableau umfasst: erstens die Jouissance des Daseins (nämlich als Ding und mystisch codiert), zweitens die phallische Jouissance (des Signifikanten, der langagière), drittens die erwähnte Jouissance des Anderen (weiblich, unaussprechlich). Die drei Zweige werden ausgewiesen als »jouissance of being, phallic jouissance, other jouissance« (S. 126). Wurzeln dafür finden sich unter anderem in Lacans D’un discours qui ne serait pas du semblant, Sem XVIII: »La jouissance sexuelle se trouve ne pas pouvoir être écrite« (17. 3. 1971), »L’écrit, c’est la jouissance« (19. 5. 1971) und weiter im gesamten Œuvre Lacans. Theoretisch ist die Feststellung Braunsteins relevant, dass der Primärprozess als Übergang der Jouissance zum Diskurs fungiert. (S. 146)
Der klinische Teil fußt auf der beeindruckenden Erfahrung des Autors. In diesem Kontext ist auch die Bezeichnung seiner Entschlüsselungen zu sehen: Jouissologie, (übersetzt: Jouissology). Er orientiert sich dabei an Jean Allouch, seinem Freund, und dessen explizitem Gebrauch von érotologie. In vier klinischen Kontextfeldern wird das Genießen entfaltet. Diese sind: Jouissance und die Hysterie, Perversion als Verleugnung der Jouissance, Sucht oder Abhängigkeit als Jouissance (Braunstein notiert @-Diction und führt zugleich eine Modifikation an Lacans objet a ein) und schließlich Jouissance im Spannungsfeld von Ethik in der psychoanalytischen Erfahrung. Über Obsession (Zwang) entschied Braunstein aus Gründen, die er hier offen lässt, nicht zu schreiben.
Im Kontext von Hysterie erscheint eine interessante Metapher, welche auf die makroökonomische Sphäre verweist: »Transference of jouissance, the funds deposited in the bank of the unconscious, quantified capital, ciphered.« (S. 177) Jouissance als der Verschiebung unterworfenes, chiffriertes Kapital. Bereits der hysterische Diskurs ist an sich eine exzellente Schaltstelle zum ökonomischen Funktionieren. Dorthin übertragen, zeigt sich das Genießen auch als eine Form von Widerstand, der zugleich der eigentliche Motor der Analyse ist.
Im perversen Diskurs dominiert »a will to jouissance« (S. 201). Für den Betroffenen existiert nur ein einziges Problem, nämlich die nötigen Mittel zu finden, in ihren Besitz zu gelangen. Der Perverse muss im Anderen Wissen generieren, dessen Komplizenschaft herstellen. Dazu muss er sich selbst einbringen und alles riskieren, sowohl sich zeigen als auch sich verbergen. Er muss mit einer Realität umgehen, die letztlich Schein ist. Muss das Phantasma funktionieren lassen, woran der Neurotiker scheitert (S. 201). Der Andere ist Ort eines Genießens, das dem Perversen unzugänglich bleibt, weil ihm ein Organ fehlt, das für ihn den Phallus vorstellt. (S. 208) Das sind spannende Ausführungen, die vor allem im Zusammenhang neue Einsichten hervorbringen. Doch soll hier einer detaillierten Diskussion nicht vorgegriffen werden.
Die erwähnte »@-Diction of Jouissance« führt mitten hinein in das gesellschaftliche Feld. Wo im Spätkapitalismus der Andere gar nicht mehr fordert, ist es manchmal zerstörerischer, als täte er es. Durch Vernichten der Sprache wird die Kapitulation des parlêtre bewirkt. Wo die Stellen eines Gottes, Königs, Herrschers, Staats, einer Partei oder des Vaters leer bleiben, ertönt ein »Mach, was Du willst, ich will davon nichts hören oder wissen«. Für Viele ist das Problem der postmodernen Gegenwart, dass Worte gesprochen werden können, deren Wirkung ausbleibt. »For many, the problem of the postmodern present is words that can be said, but lack effect. Subjects are counted but do not count; they are numbers to be used in statistics: their presence reduced to saying ›yes‹ or ›no‹ to questions in a survey. Politics becomes poll(itics).« (S. 230)
»Jouissance and Ethics in Psychoanalytic Experience« – Kapitel 8 – ist eine Passage, die niemand missen sollte. Hier finden sich Konsequenzen, die Braunstein aufgrund seiner konsistenten Durcharbeitung der Zusammenhänge nachdrücklich formulieren kann. Dazu zählt beispielsweise die Feststellung: »Psychoanalytic experience moves completely within the subject’s relation to jouissance.« (S. 235) Dieser Anspruch ist bisher kaum derart konsequent formuliert worden. Der in diesem Kapitel ausgeführte, nur schwer zu akzeptierende Bezug zu unvermeidlichem Leiden wurde eingangs erwähnt. Um dem Begehren dennoch zu seinem Recht zu verhelfen, schließt sich Braunstein einer Forderung Gérard Pommiers von 1987 an: »A subject must distinguish himself from the (superegoic) determinisms that awaited him even before birth.« (S. 270) Braunstein führt das Statement bezeichnend weiter: »He cannot live as a desiring subject if he does not distance himself from the desire of the Other and assume lack.« (S. 270) Prägnant ist auch seine Feststellung: »So-called neurosis, an ethical unease and not a disease to be categorized or medically treated, is impotence or renunciation to ›play the hand‹ in coming to be.« (S. 248) Ohne die oben erwähnte Dimension der »jouissance of being« wäre solch Existenzielles nicht formulierbar.
Eine der schönsten Passagen bewahrt Nestor Braunstein bis zum Schluss auf. Vielsagend heißt dieser Abschnitt: »On Love in Psychoanalysis« (S. 269). Hier wird abschließend das Verhältnis von Begehren und Genießen neu justiert. Dies geschieht in der spanischen Ausgabe von 2006, El Goce: Un concepto lacaniano, vor dem Hintergrund von »el amor«. Es sei Liebe, die Liebe, welche die Opposition auflöst, und sie täte dies am Ende der Analyse. Es ist nötig, hier zunächst in den spanischen Text zu schauen. Die entsprechende Szene wird so beschrieben: »(…) sólo el, el amor puede hacer que desce condascienda el goce.« Der ganze Satz lautet in der englischen Übersetzung:
Yes, the end of analysis has to do with pure love, without object, absolute, without limits, without illusions of harmony or plenitude, at the margins of the law, starting from desire, where love and only love can make desire condescend to jouissance. (S. 274)
»Condescender« und »to condescend« sind mehrdeutige Verben. Ob das Begehren also dem Genießen nachgibt, ihm entgegenkommt, in es einwilligt, zu ihm herabsteigt – man wird bis zum Ende gehen müssen, um es zu erfahren.
Interessant, dass Lacan die Richtung der Liebesvermittlung ehedem andersherum fixiert hatte: »[…] seul l’amour permet à la jouissance de condescendre au désir« (L’Angoisse, Sem X, 13. 3. 1963). Es gibt einiges zu diskutieren, gesteht man der Jouissance die dominierende Rolle in der psychoanalytischen Erfahrung zu, wie Braunstein dies tut.
Abschließend sei angemerkt, dass sich gleich zu Beginn des Textes eine wichtige Abgrenzung zwischen Lacans Verständnis von Dialektik und der Hegels findet. Bei Ersterem gäbe es nämlich keine abschließende Synthesis durch die List der Vernunft. Die Jouissance sei daher dialektisch in Lacans Verständnis. Insbesondere bei Hegel, beispielsweise in der Phänomenologie des Geistes (1807), gibt es eine Odyssee von Genießen und Genuss. Vor diesem Hintergrund habe ich mir erlaubt, Braunsteins Übersetzungsvorschlag von Jouissance in das Substantiv »der Genuss« (S. 14) in: »das Genießen« abzuwandeln. Vor allem auch das deutsche Verb »genießen« bietet alle nötigen Voraussetzungen, Lacans und Braunsteins Konzepte angemessen wiederzugeben.
Abzuwarten bleibt also, wann eine deutsche Übersetzung des brillanten Texts in Angriff genommen wird. Bis dahin können Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch erläutern, wie Genießen jenseits von Lust zu verstehen ist.
Zenaty, Gerhard: Sigmund Freud lesen. Eine zeitgemässe Re-Lektüre,
Bielefeld 2022, transcript, rezensiert von Christian Kläui
»Wenn wir die zentrale Annahme von der Spaltung des Subjekts (in bewusst und unbewusst) ernst nehmen, dann ist auch unser ›Lesen‹ dieser Dynamik ausgesetzt« (S. 12). So Zenaty im Vorwort zu seinem neuen Buch, in dem er, als Leser Freuds, sein Lesen der Werke Freuds vorstellt. Was sich hier ankündigt und dem Buch den Weg weist, ist eine Lektüre, die nicht nur darlegt, was Freud mit der Einführung des Begriffs des Unbewussten in die Welt gesetzt und in die Geschichte des Denkens und der Subjektivität eingeführt hat, sondern die diesem Ereignis auch, wie Alain Badiou sagen würde, die »Treue« hält: eine Lektüre der Texte Freuds, die nicht hinter Freud zurückgehen kann, sondern seine Lektion der Spaltung des Subjekts auf- und angenommen hat.
Zeitgemäss soll diese Lektüre sein, die als Re-Lektüre vorgestellt wird. Ohne es an die grosse Glocke zu hängen, macht Zenaty transparent, dass sein »Lesen« – im freudschen Sinne – ein Akt der Wiederholung und der Übertragung ist. Eine Wiederholung, insofern, als hier jemand schreibt, der einesteils aus der Nachträglichkeit des Heute auf die Gründungstexte der Psychoanalyse zurückschaut, und andernteils auch insofern als hier jemand, der mit diesen Texten über viele Jahre gearbeitet hat, diese für sich und uns Leser wieder liest und neu deutet. Und es ist auch ein Akt der Übertragung, nicht nur weil Zenaty Freuds Texte zusammenfassend in sein eigenes Schreiben überträgt, sondern auch weil er sein eigenes, »zeitgemässes« Fragen in die Lektüre hineinträgt.
Zenatys Buch ist kein Buch über die Geschichte der Psychoanalyse, dafür ist es trotz seiner stattlichen 388 Seiten thematisch zu begrenzt. Aber man erfährt aus diesem Buch mehr über die Geschichte der Psychoanalyse als aus manchem anderen Werk zu diesem Thema. Der Grund liegt im geschilderten Übertragungs- und Wiederholungs-Lesen: Zenaty arbeitet in Freuds Texten etwas ganz Bestimmtes heraus, das er in seinen Wirkungen und Konsequenzen bis heute verfolgt. Wenn man formulieren will, was dieses ganz Bestimmte ist, so kann man vielleicht dies sagen: Zenatys Fokus liegt auf dem, was den Unterschied ausmacht, auf dem Neuen, das Freuds Texte einführen und das vorher noch nicht gedacht werden konnte und eine neue Diskursivität zur Folge hat. Das mag etwas banal klingen, aber es bedeutet zweierlei. Zum einen kann und will eine solche Lektüre eine Parteinahme nicht vermeiden, wenn der Autor Stellung beziehen muss, wo er den Unterschied festmacht und welche gedankliche Linien in Freuds Werk er hervorhebt und sorgfältig und kenntnisreich nachzeichnet in ihrem Werden aus Selbstanalyse, praktischer Erfahrung, inneren Widersprüchen und Zögern, in ihrem Werden im Selbstgespräch und später immer mehr auch im Gespräch mit den anerkannten und verworfenen Schülern.
Und zweitens gibt es dem Autor ein Kriterium, um nachfreudianische Entwicklungen zu gewichten. Ein gutes Beispiel dafür ist seine Diskussion der Wirkungsgeschichte von Freuds Narzissmustheorie (S. 150ff.), in der Zenaty sehr klar und nachvollziehbar darlegt, wer welche Neuerungen Freuds aufgenommen oder zurückgewiesen hat. Die Rückbindung der Wirkungsgeschichte der Freudschen Texte auf das gründende Ereignis ihrer Formulierung schafft keinen Überblick über die Geschichte der Psychoanalyse und wird schon gar nicht all ihren postfreudianischen Strömungen gerecht, aber sie legt Bruch- und Konfliktlinien frei und eröffnet auf diese Weise viele Klärungen und hilfreiche Einschätzungen zum Verständnis heutiger Debatten. Dabei muss man Zenatys Parteinahmen nicht teilen, auch für Leser*innen, die anderen Traditionen der Psychoanalyse anhängen, ist Zenatys Arbeit wertvoll, weil sie kenntlich macht, um welche Einsätze sich die Kontroversen drehen.
Das Buch ist so aufgebaut, dass Zenaty wichtige Texte Freuds in ihrer Entstehungsgeschichte verortet, in ihrem Inhalt vorstellt und in ihrer Stellung in Freuds Werk und im Nachleben bis heute diskutiert. Zenaty geht dabei – mit einer Ausnahme – weitgehend historisch vor, aber er gruppiert die Texte nicht in einer schlichten linearen Chronologie, sondern ausgerichtet auf die Schlüsselereignisse in Freuds Werk, in denen das hervortritt, was den Unterschied ausmacht. Er zeigt dabei auch plausibel auf, dass die innere Bezogenheit von »Theorie« und »Technik« durch das ganze Schaffen Freuds hindurch wirkt, und zwar, wie Zenaty formuliert, mit einer »diskurslogischen Priorität« der Technik (S. 189).
Das Nachzeichnen der Entstehung von Freuds Werk ist also auch eine Setzung einer Zeitlichkeit, Zenaty spricht von »Dreizeitigkeit«. Es gibt die Zeit der Erfindung der Psychoanalyse mit den frühen behandlungstechnischen Schriften und dem bahnbrechenden Gründertext Die Traumdeutung; es gibt die zweite Zeit des »Vermächtnisses« mit den Schriften der dreissiger Jahre im Gefolge der Errungenschaften von Jenseits des Lustprinzips; und es gibt schliesslich die dritte Zeit, die die unsere ist, die »Zeit der nach-freudschen Psychoanalyse mit ihren heterogenen Schulen und Richtungen« (S. 13).
Wenn Zenaty also von zwei Zeiten in Freuds Werk spricht, beschreibt er damit eine inhärente Spannung: Auf der einen Seite stellt Zenaty bei Freud selbst eine Treue zu seinen frühen Entdeckungen fest: »Liest man Freuds Werk historisch, so erweist sich, dass grundlegende Ideen und Konzepte vom frühen Entwurf bis zum letzten Text des Abriss sich erhalten, modifiziert und ausdifferenziert haben« (S. 307).
Und auf der anderen Seite brechen neue Gedanken hervor, die die bisherigen Errungenschaften sprengen: »Jenseits des Lustprinzips muss, wenn wir die tiefgreifende Wirkung sowohl auf Freuds weitere Theoriebildung als auch auf die Entwicklung der Psychoanalyse bis heute bedenken, als ›Gründertext‹ ähnlich wie Die Traumdeutung verstanden werden. Die fundamentale Neufassung der Trieblehre macht ein Überdenken und Neujustieren so gut wie aller psychoanalytischen essentials notwendig« (S. 306).
Ein »close reading« der Texte und Theorien im Detail ermöglicht es Zenaty herauszuarbeiten, wie dies zusammengeht. Seine Deutung reflektiert gewiss auch unsere heutige Position der Nachträglichkeit, in der sich die Frage von Kontinuität – in einem kulturellen und psychotherapeutischen Umfeld, das der Psychoanalyse, vorsichtig gesagt, mit wechselnden Sympathien begegnet – und Neubegründung immer wieder neu stellt. Jedenfalls liegt das Schwergewicht von Zenatys Ausführungen zur dritten Zeit bei Lacan und der lacanianischen Ausrichtung der Psychoanalyse, die exemplarisch zeigt, dass eine Rückkehr zu Freud zugleich eine Neuerfindung sein muss, will sie nicht historisch und steril bleiben.
Ausgenommen von seinem Vorgehen, den historischen Linien zu folgen, hat Zenaty die kulturtheoretischen Schriften Freuds, die er an den Schluss des Buchs stellt. Ich würde diesen Verzicht, die Stränge der Individual- mit denen der Sozial- oder Massenpsychologie ineinander zu verweben, als Symptom verstehen: insbesondere auch, weil Zenaty aufzeigt, dass die Stellung der kulturtheoretischen Schriften bereits in Freuds Werk und besonders in dessen postumer Rezeption schwankend bleibt. Zenaty weist die Idee, Freuds Reflexionen über Gesellschaft und Kultur als »Privatmeinung« und als »Zusatz« zur Psychoanalyse zu betrachten, zurück und begreift sie vielmehr als eine ausdifferenzierende Entfaltung derselben (S. 310). Die dritte Möglichkeit, von einer wirklichen inneren Verbindung im Sinne eines Verhältnisses wechselseitiger Inspiration auszugehen, insofern als es um die im Individuellen wie im Kollektiven grundlegende Beziehung des Einzelnen zum Andern geht, wird allerdings auch angedeutet. Sie würde es ausschliessen, Freuds »Projekt einer Kulturtheorie« aus der Lektüre der klinischen Schriften auszuschliessen und diesen nachzuordnen. Was könnte eine derartige Re-Lektüre hervortreiben? Vielleicht, ich möchte es anregen, schreibt Zenaty darüber einen zweiten Band? Das Buch richtet sich an alle an der Psychoanalyse interessierten und mit ihr beruflich befassten Leser*innen, es ist über Grenzen der unterschiedlichen psychoanalytischen Ausrichtungen und Schulen hinaus mit Gewinn lesbar. Seine Sicht auf die postfreudianischen Kontroversen ist eine kenntnisreiche und pointierte Orientierungshilfe. Die inhaltlichen Einlassungen zu den Texten Freuds sowie ihre Zusammenfassungen werden ihren Platz auch in Aus- und Weiterbildung haben und bestenfalls anregen, Freuds Originaltexte dort wieder mehr zu berücksichtigen.
Langnickel, Robert: Prolegomena zur Pädagogik des gespaltenen Subjekts. Ein notwendiger RISS in der Sonderpädagogik, Leverkusen 2021, Barbara Budrich Verlag, rezensiert von Jean-Marie Weber
Ob Robert Langnickel bei der Formulierung seines Titels an Kants Prolegomena zu einer zukünftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können (1783) gedacht hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Mit seiner Dissertation reflektiert er, inwiefern die strukturale Psychoanalyse einen »Riss« und damit wohl eine »Zeitenwende« in der (Sonder-)Pädagogik zum Unbewussten hin promoviert. Ähnlich wie bei der in die Krise geratenen Metaphysik durchzieht die publikationsbasierte Dissertation wie ein roter Faden die Frage nach dem Platz der Psychoanalyse im pädagogischen Kontext: Ist die Psychoanalyse als Heuristik mit ihrem speziellen Setting der Kur im pädagogischen Feld umsetzbar und welches sind die Bedingungen für ein solches Unterfangen?
Förderung des Menschen als gespaltenes Subjekt
Für Lacan gilt der Mensch als gespaltenes Subjekt zwischen dem Unbewussten und Bewussten, zwischen Wissen und »nicht gewusstem« Wissen, Sinn und Leere, zwischen dem absichtlichen Sprechen des »Ichs« und dem Unbewussten als dem Diskurs des Anderen, zwischen Trieb und Begehren, Eros und Thanatos. Dieser anthropologischen Tatsache muss die pädagogische Praxis wie auch die Theorie Rechnung tragen. Das heißt vor allem, offen sein für das Subjekt, das immer noch ankommt. Pädagogik hat somit nicht mehr nur das Ziel, den Zögling zu normieren und ihn zum Bürger zu erziehen, sondern seit Rousseaus Émile auch, ihn anzuleiten autonom zu werden und sich als begehrendes Wesen zu konstituieren.
Inwiefern kann Psychoanalyse dabei unterstützend wirken? Der Autor zeigt anhand unterschiedlicher Konzepte der strukturalen Psychoanalyse, dass sie für die Pädagogik von Bedeutung und für den sonderpädagogischen Bereich übersetzbar sind. Dies gilt neben dem Theorem des gespaltenen Subjektes u.a. für die Triade des Realen, Symbolischen und Imaginären, aber auch für die Übertragung, das Phantasma, die Affekte Liebe und Hass, die Problematik der Dyade und die Notwendigkeit des Triangulierens oder die Bedeutung des Spiels.
Schon Freud hat sich mit der Frage nach der Relevanz von Psychoanalyse für die Pädagogik beschäftigt, da die Erziehung einen verhängnisvollen Einfluss auf das psychische Leben der Heranwachsenden haben kann. Auch politisch-strategische Gründe oder Freuds Gegenübertragung auf seine Tochter Anna spielten hier eine Rolle. Dabei ging es ihm immer darum, zwischen dem Platz des Erziehers und des Psychoanalytikers zu unterscheiden, damit es zu keiner Konfusion zwischen den unterschiedlichen Perspektiven kommt. Dem Pädagogen geht es darum, Wissen und Werte zu vermitteln bzw. die Zöglinge mit ihren unterschiedlichen »Bedürfnissen« den schulischen und sozialen Anforderungen soweit wie möglich anzupassen, damit sie dem »Realitätsprinzip« entsprechend handeln und ihr singuläres Lebensprojekt entwickeln können. Dem Psychoanalytiker aber geht es darum, das Subjekt dort zu suchen, wo es vor dem anderen und sich selbst flüchtet, sei es durch Verdrängung oder Verwerfung, wie u.a. Maud Mannoni in L’enfant, sa maladie et les autres (1967) schreibt. Ziel ist, dass das Unbewusste denkt, d.h. arbeitet.
Eine Kooperation zwischen der Psychoanalyse und der Pädagogik sieht Langnickel in der von Maud Mannoni gegründeten Institution von Bonneuilwie auch in der von Françoise Dolto gegründete Maison Verte. Es sind »temporäre Durchgangsorte«, wobei das Spezifische dieser Institutionen darin liegt, dass die psychoanalytische Sicht von der Institution gewünscht ist und ihren Platz bekommt und insofern auch die spezifische Arbeit der ErzieherInnen beeinflussen kann.
Ohnmachts- und Machtphantasien
Mit Recht weist der Autor darauf hin, dass sich die PädagogInnen, aufgrund von Übertragungsprozessen, denen sie unterworfen sind, ihrer Ohnmachts- und Machtfantasien, ihrem Genießen bewusst werden sollen. Sie sollen einen dritten Ort finden, wo sie diese symbolisch verarbeiten können. Dies ist eine fundamentale Voraussetzung für eine offene Begegnung mit den SchülerInnen, das heißt ein Hören, das nicht narzisstisch auf sich selbst konzentriert ist und nur das hört, was das Gegenüber erwartet. Solche Offenheit für die Mehrdeutigkeit des Gesprochenen ermöglicht, ohne unbedingt zu interpretieren, dass die Heranwachsenden der Spur ihres Begehrens nachforschen können. In diesem Zusammenhang sieht auch Catherine Millot in Freud anti-pédagogue (1979) einen möglichen Einfluss der Psychoanalyse auf die PädagogInnen, insofern sie ihnen helfen kann, eine professionelle Ethik zu entwickeln, die Ohnmacht in Unmöglichkeit verwandelt, pädagogische Ideale entmystifiziert und durch die Liebe zur singulären Wahrheit ersetzt.
Mentalisierung als Rettungsanker für die psychoanalytische Pädagogik?
Das »Mentalisieren« hat als Ziel, Interaktionen zu verstehen, sogar vorherzusagen und Affekte zu modellieren. Das reflektierende Ich soll gestärkt werden. Dies ist sicherlich ein nicht zu verwerfender pädagogischer und therapeutischer Ansatz. In verschiedenen Modellen werden dazu Skalen der Mentalisierungskompetenz entwickelt. Allerdings stellt sich dann die Frage nach der Konzeption des Unbewussten und inwiefern ein solcher Ansatz mit einer strukturalen Psychoanalyse vereinbar ist. Letzterer geht es ja letzten Endes um die Aufarbeitung und Rekonfiguration des fundamentalen Phantasmas. Gerade hier zeigt sich für mich, wie der Autor aufgrund der Krise der Psychoanalyse (im pädagogischen Feld) nach einem Ausweg sucht. So sollte die Mentalisierungstheorie wie u.a. auch die Neuro-Psychoanalyse der Psychoanalyse helfen, anschlussfähiger an den akademischen Diskurs zu werden. Und weiter: »Eine Ausbildung in mentalisierungsbasierter Pädagogik wäre gerade nicht an diese hohen Anforderungen einer Lehranalyse gebunden und könnte somit niederschwellig eine breite Personengruppe erreichen und Vorverständnis für die psychoanalytische Pädagogik durch Selbsterfahrungselemente einer begleitenden Supervision legen.« (S. 115)
(Sonder-)Pädagogik als Feld der Begegnung
Es ist erstaunlich, wie fruchtbar die strukturale Psychoanalyse für die Philosophie und die Philosophie für die Psychoanalyse war. Sie begegneten sich, ohne dass es zu Fusionen und Konfusionen kam. Sollte dies nicht auch ein Modell für die Beziehung zwischen Psychoanalyse und Pädagogik sein? Beide lernen vom anderen, sich ihrer Unvollständigkeit, ihrer immanenten Unmöglichkeit zu stellen.
In bestimmten Situationen zeigt der Erzieher den Heranwachsenden, was er von ihnen erwartet und wie er sie auf der Ebene der Wissensobjekte oder der Sozialisationsziele unterstützen kann. Falls angebracht, kann er Einzelne aber ermutigen, an einem anderen Ort, d.h. dem analytischen Setting der Kur, ihr Unbewusstes »frei« denken zu lassen und an ihrer Triebkonfiguration zu arbeiten, um als Subjekt neu anzukommen. So kommt es zu einem Miteinander ohne Vermischung.
Zur Konfusion kommt es auch nicht, wenn die Lehrenden im Sinne des »quoi de neuf«der Pédagogie Institutionelle agieren, die Gruppe sich dem »Gesetz des Sprechens« unterwirft oder wenn PädagogInnen etwa im Sinne der Work Discussions Situationen analysieren und Übertragungsprozesse bewusst machen. Robert Langnickel hat mit dieser Arbeit die wichtigen Herausforderungen und Diskussionen um die Beziehung zwischen Pädagogik und Psychoanalyse aufgezeigt und sich dabei mit namhaften französischen VertreterInnen dieser Bereiche auseinandergesetzt. Er hat Möglichkeiten eruiert, wie ErzieherInnen von der Psychoanalyse profitieren können, um mehr zu sehen als ein störendes Verhalten und mehr zu hören als Eindeutigkeiten. Pädagogische Settings können Übertragungen bewusst machen, aber eine Analyse von Übertragungsprozessen kann so nicht stattfinden. Der Psychoanalytiker darf nie ein Erzieher sein, sagt Lacan. Und die ErzieherInnen stehen sich selbst und dem Jugendlichen im Weg, wenn sie konsequent die Arbeit des Unbewussten und die Rekonfiguration der Triebökonomie visieren. Wegen solcher Missverständnisse und um Illusionen vorzubeugen, scheint es mir wichtig, den Begriff der psychoanalytischen Pädagogik fallenzulassen und die Energie in einen konsequenten Dialog zwischen Pädagogik und Psychoanalyse zu investieren. Dafür wünsche ich Robert Langnickel, der für seine Arbeit mit dem Siegfried-Bernfeld-Preis ausgezeichnet wurde, viel Erfolg!
Butler, Judith: Sinn und Sinnlichkeit des Subjekts. Übers. aus dem amerik. Englisch: Kleinbeck, Johannes; Precht, Oliver; Ruf, Kianush; Schurian, Hannah, Wien, Berlin 2021, Turia & Kant, rezensiert von Simon Scharf
Auch wenn die spätmoderne Gesellschaft ein regelrecht obsessives Verhältnis zum Körper besitzt, erreichen die Diskurse zur Bedeutung desselben nur selten philosophische Tiefe. Judith Butlers Essaysammlung Sinn und Sinnlichkeit des Subjekts aber, die Beiträge der Jahre 1993 bis 2012 versammelt, leuchtet auf vielfältige Weise und im Dialog mit zentralen Positionen der Philosophiegeschichte die Möglichkeiten einer Ethik des sinnlichen Subjekts aus.
Ausgehend von der Ursprungsbedeutung des »Subjekts« als eines dem Diskurs unterworfenen begreift sie den Einzelnen – mit Foucault gesprochen – als diskursiv produziert: Normen, Konventionen und institutionelle Formen üben dabei eine derart immense Kraft aus, dass Butler von einer »iterativen Logik« (S. 12) spricht, die sich über das Leben der Individuen hinausgehend immer weiter fortsetzt und Gesellschaft auf diese Weise machtvoll prägt. Entscheidend ist Butlers Verständnis des Konflikthaften und Dialektischen: Sie will keinesfalls einer Vorstellung des passiven und fremdbestimmten Subjekts das Wort reden, sondern sieht eher ein komplex aufgezogenes Kraftfeld der Widersprüche und Kämpfe im Ringen um die eigene Position.
In diesem Sinne definiert Butler das Ethische im Subjekt als ein Bestreben, die Spannung zwischen dem eigenen Geformt-Werden durch die Gesellschaft und eigenen Handlungsspielräumen der Formung zu verstehen. Das eigene Leben ist damit der fortwährende Versuch, sich einzubinden und zugleich Kräfte und Beschränkungen durch Prägungen und Normierungen zu verstehen. Auf diesem Weg, die »kreuzenden Bedingungen der Formierung« (S. 27) zu erkennen, wird dann ein komplexes Bündel der Beziehungen erkennbar, ein Geflecht, das die eigenen Interpretationen und Positionen herausfordert und immer wieder in Bewegung versetzt. Die Sprache selbst wird in diesem Prozess zum Werkzeug, das einer ähnlichen Logik folgt: Sie ist eine bewegliche Sprache, die zwischen verschiedenen Polen der Formung oszilliert und immer das Scheitern miteinbeziehen muss. Über die Gesellschaft, das Ich oder den eigenen Körper zu sprechen, meint damit auch, Irrwege, Fehlinterpretationen und Aporien des sprachlichen Zugangs als konstruktiv und hilfreich aufzufassen, um neu anzusetzen – die Suche nach Gewissheit intensiviert so den Zweifel in seiner produktiven Kraft.
Mit diesen Vorarbeiten wendet sich Butler im Folgenden ihrem hier zentralen Fluchtpunkt zu: dem Körper. Von besonderer Wichtigkeit ist dabei ihre faszinierende Rückkopplung des Körpers an das Geistige, das Subjektkonstituierende, mit der sie sämtliche Dualismen zugunsten einer performativen Durchdringung beider Ebenen überwindet: Es ist der Körper, »der die Seele beseelt« (S. 65); umgekehrt erweist sich das Bewusstsein als diejenige Form, die »der Körper annimmt, wenn er ideell wird« (S. 73). Auf diese Weise wird die titelgebende Koppelung von »Sinn« und »Sinnlichkeit« überaus deutlich – im Rekurs auf den Körper weitet sich der Blick auf Subjektivität und Identität des Einzelnen, der über das Körperliche Erkenntnisse gewinnt.
Spannend und anregend sind im Anschluss daran Butlers Lesarten prominenter philosophischer Positionen zu Formen der Körperlichkeit, die gleichsam als wichtige Anwendungen zu Bestandteilen ihrer Konzeption werden: So entwirft sie mit Maurice Merleau-Ponty eine Idee der Berührung, die Ausgangspunkt von Empfindung, Gefühl und Denken ist, nahezu »beseelendes Prinzip des Fühlens und Erkennens« (S. 64). Das Berühren des Anderen und das Berührt-Werden des Ich sind gleichermaßen Möglichkeiten, das eigene Denken zu befruchten und eigene Formen der Handlungsmacht definieren zu können. Im Begehren zeigen sich darüber hinaus Umrisse einer sozialen Ethik: In Fortführung von zentralen Ideen Spinozas meint Begehren so immer Externalisierung und Ausweitung des Ich auf den Anderen. Die Sehnsucht, sich auf den anderen Körper zu beziehen und sich diesen »einzuverleiben«, verwickelt das Ich in eine Art »Gesellschaftlichkeit« des eigenen Begehrens und bewirkt ein (bei Butler generell signifikantes) chiastisches Verhältnis von Individuum und Kollektiv. Ausgehend vom Begehren ist schließlich die Liebe selbst Teil einer umfassenden Idee des sinnlichen und mit Sinn aufgeladenen Körpers: In der Ausrichtung auf den Anderen will sich der Einzelne »desorientieren« und selbst überschreiten; sich selbst weiterzuentwickeln im Rahmen der Liebe bedeutet dann (im Hegel’schen Sinne) die Dialektik zwischen dem »Zorn auf die eigene Individualität« (S. 144) und dem Ringen um Individualität auszugestalten und in der Liebesbeziehung auf besondere Art und Weise zu leben. Weitergeführt wird daraus – so zeigt Butler sehr instruktiv auf der Grundlage der Positionen von Merleau-Ponty und Luce Irigaray – eine Art »ethische Beziehung zwischen den Geschlechtern« (S. 210), die alle Hierarchie, aber auch alle Formen der Wechselseitigkeit und Anpassung überwindet und zu einer Anerkennung des Widersprüchlichen und der radikalen Frage nach dem DU der Beziehung kommt:
Ich bin nicht derselbe wie der ANDERE. Ich kann den ANDEREN nicht am Modell meiner selbst begreifen. Der ANDERE ist wesentlich jenseits von mir und ermöglicht mich in dieser Hinsicht, indem er mich begrenzt. Dieser ANDERE, der nicht ich ist, bestimmt mich außerdem wesentlich dadurch, dass er genau das darstellt, was ich nicht an mich und das, was mir schon bekannt ist, angleichen kann. (S. 212)
Auch wenn Butler im Rahmen vorheriger Schriften die Basis ihrer philosophischen Konzeption bereits gelegt hat und in Sinn und Sinnlichkeit des Subjekts an der einen oder anderen Stelle re-vitalisiert, so besticht der übersichtliche Essayband doch durch den roten Faden einer auch interdisziplinär unbedingt bedenkenswerten »Ethik der Körperlichkeit«, wenngleich die einzelnen Texte immer wieder auch neue Kontexte, Detailbeobachtungen und Lesarten offenlegen, die Wertvolles zutage fördern. Mit Butlers deutlichem Rekurs auf Phänomenologie und feministische Theorie ist sie in jedem Fall – wenn dies nicht bereits vorher in besonderem Maße der Fall war – überaus anschlussfähig für psychoanalytische Diskussionen.
Žižek, Slavoj: Das erhabene Objekt der Ideologie.
Übers. aus dem Englischen: Aaron Zielinski, Wien 2021, Passagen, rezensiert von Simon Scharf
Das erhabene Objekt der Ideologie von Slavoj Žižek ist kein neuer Text (erschienen 1989 bei Verso), aber in seiner Fokussierung auf den Begriff der Ideologie in diesen sicher nicht post-ideologischen Zeiten erschreckend aktuell. Bei aller Gegenwärtigkeit zielt er vorrangig auf ein neues Verständnis des Ideologischen auf der Grundlage einer engen Verzahnung von lacanianischer Psychoanalyse und hegelianischer Dialektik, um erstere philosophisch zu rehabilitieren und das Subjektive der Psychoanalyse mit objektiven Momenten der Ideologiebildung kritisch zusammenzuführen.
Žižek koppelt sein Ideologie-Verständnis auf überaus instruktive Weise zurück an psychoanalytische Grundannahmen zum Subjekt: Der Mensch ist in seiner Triebstruktur ein zutiefst antagonistisches, ja widersprüchliches und konfliktbehaftetes Wesen. Weil jeder Versuch der Abschaffung und Überwindung dieses triebbedingten Widerspruchs (als »interne Bedingung jeglicher Identität«, S. 34) ins Totalitäre kippt, bleibt dem Einzelnen nichts anderes übrig, als einen modus vivendi zu finden, um den Konflikt als Motor der Lebensführung anzuerkennen. Darüber hinaus ist das Subjekt mit der Tendenz zur Wiederholung konfrontiert; eingespielte Muster triebhaften Verhaltens kehren so immer wieder – als »weiße Flecken« des Nicht-Symbolisierten, des Nicht-Versprachlichten, sind sie im Sinne Lacans als das »Reale« definiert, als Leerstelle und traumatisches Ereignis, das sich der Symbolisierung (die im Wesentlichen durch die Sprache geleistet wird) entzieht. Auf dieser Grundlage erscheint das Subjekt als Mangel und Leerstelle, als Frage und »Platzhalter«. Eng an Vorstellungen Lacans angelehnt, wird es zum Subjekt der Negativität, das sich im Prozess der Subjektivierung erst den positiven Raum der Selbstformung erschließt und gangbar macht. Es ist sich immer ein Anderes und fremde Substanz und kann erst in der Auseinandersetzung mit den eigenen blinden Flecken zum Ich werden.
Die Ideologie nun ist ihrem Kern nach eigentlich analog zu sehen zum Subjekt vor aller Subjektivierung, vor aller Bewusstwerdung der eigenen Konflikthaftigkeit – das scheint gewissermaßen der spannende Punkt der Verknüpfung beider Ebenen zu sein: Žižek beschreibt das Ideologische als Illusion, als Form des Nicht-Wissens, der Naivität und Selbstbezüglichkeit. Im Rekurs auf eine Ideologie (im Text ist vorrangig der Warentausch als Fetisch gemeint) wird das Wesen von etwas verschleiert, die Voraussetzungen und tatsächlichen Bedingungen verkannt, sodass es eine Diskrepanz zwischen gesellschaftlicher Wirklichkeit und illusionärer Repräsentation gibt. Das, was hier allerdings als Dualismus anklingt, ist im Sinne Hegels immer dialektisch zu denken: Žižeks Text trennt nicht zwischen Illusion (Ideologie) und Realität (gesellschaftlicher Wirklichkeit), sondern setzt eine Durchdringung beider Sphären voraus; die Illusion erscheint als Gefahr der Verkennung der gesellschaftlichen Realität und ist zugleich ihre Kompensationsmöglichkeit – eine Spannung, der man sich stellen muss. In diesem Sinne gibt es keinen Fluchtpunkt »jenseits der Ideologie«, das Ideologische ist integraler Bestandteil unserer Wahrnehmung von gesellschaftlicher Wirklichkeit und wird als solches auch bewusst oder unbewusst akzeptiert, erwünscht, erhofft – als Phantasma des Genießens.
Wie ist mit diesem Faktum des Ideologischen umzugehen? Žižek entwirft eine ideologiekritische Praxis, die bestechenderweise der subjektiven Ebene der Analyse folgt: Im Stile einer diskursiven Dekonstruktion muss es darum gehen, offenzulegen, wie sich bestimmte gesellschaftliche Vorstellungen gebildet, konstituiert und weiterentwickelt haben. Im Modus der Selbstkritik muss dabei auch das eigene »Verkennen« analysiert und gezeigt werden, inwieweit die Ideologie als geschlossene Form der Weltwahrnehmung bislang ohne ein kritisches Außen wirken konnte, sie letztlich aber immer »Ausdruck/Effekt eines verborgenen Mechanismus« (S. 299) ist. Genauso also wie sich das Subjekt in der Analyse an den eigenen Widersprüchen, dem Unhinterfragten und den sich wiederholenden Verhaltensweisen abarbeitet und einen modus vivendi etablieren kann, der das eigene Gewordensein rekonstruiert, formuliert Žižek Möglichkeiten für eine Gesellschaft, sich den eigenen Phantasmen und Illusionen zu stellen und sie aufzuarbeiten.
Was in dieser Rezension wie eine klar ersichtliche (und zuweilen vielleicht arg schematisch anmutende) Argumentationsstruktur des Textes aussieht, zeigt sich in Žižeks Buch als hervorragend komponierte, assoziativ verschachtelte und detail- und anspielungsreiche Form eines enorm stilbewussten Denkers, der den Gegenstand auf eine Weise durchdringt, die ein hohes Maß an Lesbarkeit und Anspruch offenlegt. Dass dabei ein hochinteressanter Brückenschlag zwischen Hegels Philosophie und Lacans Psychoanalyse gelingt und obendrein noch das politisch-ideologiekritische Potenzial der Psychoanalyse ausgelotet wird, ist nicht hoch genug einzuordnen und rechtfertigt in besonderem Maße das Zugänglichmachen dieses möglicherweise sogar zeitlosen Textes.
Scharf, Simon: Krise – Subjekt – Literarische Form.
Dissonanz erzählen im Werk von Terézia Mora, Reinhard Jirgl und Peter Wawerzinek, Berlin 2021, Frank & Timme, rezensiert von Martin A. Hainz
Identität ist ein fragiles und zugleich gefährliches Konstrukt, eines, das man vielleicht reklamiert, eines, dem man – und sei’s subjektiv – zu genügen habe, eines, zu dem man sich, wer oder was das auch sei, mitunter geradezu genötigt verhalte. Ferner konstituiert Identität Politik, das angeblich Gemeinsame; die Spät- oder Postmoderne wisse Scharf zufolge um das Problematische an alledem; und sie misstraut alledem, ohne aber die »Sehnsucht nach einer gemeinsamen und verbindlichen (Lebens‑)Ordnung« (S. 17) zu bagatellisieren, wie Scharf zu zeigen sucht. Identität sei also das, was die Auseinandersetzung anstrebt, worin ihr beschieden wird, dass oder ob und auch was sie sei.
Werke von Terézia Mora, Reinhard Jirgl und Peter Wawerzinek entwickeln diese Konstellationen, wie Scharf in seinem Buch zeigt, das zwar literaturwissenschaftlich ist, aber die Literatur dabei als ein Erzählen – ein performatives Sich-Erzählen – soziologisch wie psychologisch und psychoanalytisch untersucht. Literatur ist dann das, worin die lebensweltliche Beliebigkeit gezeigt und die Lebenswelt mitunter auch (neu) geordnet wird. Dabei arbeiten sich das Subjekt und damit verbundener Anspruch am Realen ab. (S. 37–39)
In die psychosozialen Prozesse, die so entstehen, die aber auch antreiben, was so entsteht, taucht Scharf zunächst mit Mora ein: in ihre Odyssee bzw. Orientierungslosigkeit, die immerhin keinen heteronomen Ansprüchen ausgesetzt ist. Die Bewegung wird zur Hoffnung, vielleicht auch zum Ziel. Statt eines Orts wird diese Bewegung Heimat – ebenso wie das Selbst in der analytischen Arbeit besteht, ein Selbst in einem zuträglichen Sinne zu werden. Interessant ist dabei, wie die Probleme der Begriffe dessen, was auch jenseits der Lokalität Heimat oder Norm wäre, verhandelt werden: Die Trennung vom Datenstrom gerate zur Isolation. (S. 140) Diese ist aber auch eine Chance auf »Stille und Maß« (S. 141). Möglicherweise ist die Trennung aber schon zuvor gegeben und, wo sie als vollzogene daherkommt, Kitsch.
Die gelegte Spur verfolgt Scharf an Jirgl weiter, der das Ökonomische und Politische noch stärker akzentuiert, die Stadt als modernstes Bio- und Soziotop ist hier gerade kein »Lebensraum« (S. 278) mehr, sondern ein »Sprach-Skelett« (ebd.), worin der Austausch fehlt. Identität bildet sich hier nicht als Prozess, woran das Selbst und andere beteiligt werden, sie wird allenfalls zugewiesen, und zwar als Funktionalisierung. Die Naturräume bleiben dann die Möglichkeitsräume, wobei auch Natur eine Funktionalisierung sein könnte. Die globalisierte Stadt Jirgls weist Natur als etwas, das seinen Begriff – wieder: vor allem auch sprachlich – herausforderte, kaum auf … Noch im Zwischenmenschlichen herrschen konsumistische Verhaltensweisen vor, in denen beispielsweise Nymphomanie und die als finanzielle Transaktion verstandene Ehe quasi miteinander harmonieren. (S. 339)
Peter Wawerzineks Werk ist das dritte, woran Scharf zeigt, wie die »situativ und projekthaft gewordene Identität« (S. 397) heute aussehen mag. Der Verlust der Mutter ist hier der Beginn einer Identität, die sich diasituativ realisiert, ohne Kontinuität und Selbstversicherung jenseits der Zuschreibung. Es gibt hier also einen »irreparablen Bestandteil der Identität« (S. 402), Identität nahezu ausschließlich als Passion oder Last. Selbst- und Sprachaneignung oder deren Zusammenhang bleiben auch bei diesem Autor – oder genauer: dem, was er analysiert – aus.
Ordnung? – Denkbar, und zwar als geglückte, ist oder wäre sie nur jenseits dessen, im Durchgang, in der Entwicklung dieser Dissonanzen, wobei Denkbarkeit keine Sicherheiten impliziert. Immerhin, so legt Scharf nahe, gebe es expressis verbis Irreparables. Man könnte, während sich die Beobachtungen, die Scharf zusammenträgt und bilanziert, meist kaum bezweifeln lassen, die anschließende Hoffnung, dass »Literatur […] gesellschaftlich-identitätsstiftend werden kann«, wie Scharf vermutet, »und ob sie das werden soll, […] getrost dahingestellt lassen« (S. 10), wie Hartmut Rosa im Vorwort des Bands schreibt. Insgesamt ein spannender Beitrag zu dem, was Menschen umtreibt – vielleicht in die Praxen von Psychoanalytiker*innen.
Wilm, Heidi; Unterthurner, Gerhard; Storck, Timo; Kadi, Ulrike; Boelderl, Artur R. (Hg.), Körperglossar, Wien, 2021, Turia + Kant, rezensiert von Walter Seitter
Unter einem Glossar versteht man eine Liste von Worterklärungen (etwa etymologischen oder semantischen), die häufig ans Ende eines Buchs gesetzt wird, sodass das Glossar zu anderen Registern und Verzeichnissen hinzukommt.
Das vorliegende Buch jedoch tituliert sich insgesamt als Glossar, scheint also die für wissenschaftliche Schriften übliche Textform der Abhandlung von sich zu weisen. Diese entspricht dem abwägenden und flexiblen Duktus eines Autors, der seine Gedanken darstellen, mitteilen, plausibel machen will. Hingegen wirkt die Textform des Glossars irgendwie vorgefertigt und steif – sei es, dass sie ans arithmetische Aufzählen oder an die Geometrie der Liste erinnert.
Das Inhaltsverzeichnis des Buches steigert diesen Eindruck, werden doch die einzelnen Glossen (es sind fast vierzig) uniform so benannt, dass dem einen und selben Wort »Körper« (im Plural) adjektivische Weiterbestimmungen zugesetzt werden, genauer gesagt vorgesetzt werden (weil die deutsche Sprache diese Wortstellung erfordert).
Aus der Simplizität dieses Schemas muss man den Herausgeberinnen und Herausgebern nicht unbedingt einen Vorwurf machen: es ist die Simplizität, Wohlbekanntheit und vielleicht auch Unvermeidlichkeit einer der aristotelischen Ontologie-Dimensionen, nämlich der Polarität zwischen dem Wesen und den Akzidenzien.
Indessen könnte man die grafische Priorität der (vielen) Eigenschaften vor den oftmals wiederholten Körpern doch auch in die Richtung lesen, dass die unterschiedlichen und divergierenden, ja turbulierenden Akzidenzien, also Zustöße, das Gleiche der Körper doch zu zerfransen ja zu zersetzen drohen. Dies umso mehr als viele der Akzidenzien mit aktiven oder passiven Partizipien ausgedrückt werden – womit Tätigkeiten und Leiden, Dominanzen und Schicksale sich in den Vordergrund drängen. (Selbst bei Aristoteles taucht so etwas wie ein heterodoxer Akzidenzialismus auf).
Über die vielen Akzidenzialitäten, die den Menschenkörpern zugeschrieben werden, löst sich deren begriffliche Bestimmtheit tatsächlich tendenziell auf.
Eine nähere Besichtigung der vielen Beiträge bestätigt eine solche Vermutung, und im übrigen ist die normale Textform der wissenschaftlichen Darstellung, die Abhandlung, keineswegs aus dem Glossar verbannt – jeder der Beiträge ist eine solche.
Es ist aber auch zum »Hauptwort« des Körper-Glossars gleich etwas zu sagen. Im Vorwort werden »alle Körper« als Thema oder Sujet des Buches angekündigt – wobei die Ankündigung sofort wieder halb zurückgenommen wird. Es wird aber so gut wie ununterbrochen vorausgesetzt, dass nur von Menschenkörpern die Rede ist bzw. sein wird – was gleichzeitig aber gar nicht deutlich gesagt wird, zumal die Angabe der Spezies »Mensch« im ganzen Buch ausfällt, höchstens wird sie mit dem deutschen Sonderwort »Leib« angedeutet.
Es findet eine paradoxe Überkreuzung statt zwischen einem thematischen Anthropozentrismus, der nur Menschliches oder Menschenhaftes zulässt und abhandelt, der aber diese Einschränkung gar nicht offenlegt – weil anscheinend das Vokabular für die Offenlegung nicht zur Verfügung steht oder weil irgendein Verbot die Offenlegung verhindert.
Und das Ganze unter der formellen selbstgewählten Titulatur »der Körper«, die sogar »alle« Thema sein sollen.
Alle Körper – die reichen immerhin von den Himmelskörpern (zum Beispiel Schneeflocken) bis zu den vielen Sachen, die man in den Geschäften kaufen kann (allerdings gegessen und getrunken transsubstanziieren sie sich in – Menschen (plus Abfall)).
Bei ungefährer Durchsicht stößt man im Körper-Glossar nur auf zwei Körper-Sorten, die man nicht direkt den Menschenkörpern zuschlagen kann: Tierkörper, Schriftkörper. Beide Körpersorten sind allerdings den Menschenkörpern nicht ganz fremd. Die Tierkörper umfassen generisch die Menschenkörper – und zwar nicht etwa nur rein logisch: das Animalische ist aus den Menschenkörpern nicht auszutreiben (auch wenn es versucht wird); und die Schriftkörper sind menschliche Artefakte (wie zum Beispiel das besprochene Buch), die die Artistik in die Menschennatur eingravieren. Solche Übergangsphänomene klingen in den meisten der zugeschriebenen Akzidenzien an.
Und doch – wie kommt es, dass in so einem »intellektuellen« Buch eine grundsätzliche Begriffsunklarheit zum Zug kommt? Die Herausgeber sind Philosophen und Psychoanalytiker – bei diesen gehört sie vielleicht zum Selbstverständnis, denn sie behalten ja auch die Seele (mit wenig mehr Berechtigung) allein den Menschen vor. Aber die Körper – noch dazu »alle«?
Es gibt sehr wohl eine positionale Anthropozentrik, die man behaupten kann oder vielmehr muss, denn sowohl Psychoanalytiker wie auch Philosophen und alle anderen Spezialisten und Laien sind Menschen und nichts besseres und können nur von dieser spezifischen Position aus schreiben, reden, tun und leiden. Aber thematischer Anthropozentrismus ist nur gerechtfertigt, wenn er sich deklariert und sein Schild vor die Tür hängt.
Das tun die Philosophen dann, wenn sie von menschlichen Dingen reden und diese Themenwahl nicht mit »Meta«-Begriffen wie »Geist« oder »Sein« vernebeln.
Den Schritt zur Klarstellung der Menschenthematisierung haben im 20. Jahrhundert nach Christus die Philosophen getan, die sich als philosophische Anthropologen bezeichnet haben – und sie werden im Körper-Glossar immerhin gelegentlich marginal erwähnt (Max Scheler, Helmuth Plessner, Arnold Gehlen).
Indem sie die Menschen ausdrücklich von näheren oder ferneren natürlichen Verwandten wie den Tieren oder Pflanzen absetzen, konstellieren sie sie auch mit weiter entfernten Wesen, mit denen sie allerdings auch höchst nahe und höchst notwendig koexistieren – etwa der Erde, dem Wasser, der Luft und so weiter und damit die kosmische (oder und chaotische) Dimension des Universums anpeilen, welche jedweden Anthropozentrismus in die Schranken weist.
Die Integration der Menschenspezialitäten in größere Parameter geschieht in vielen Beiträgen des Körper-Glossars allerdings sehr wohl – wenngleich auf verstecktere, man könnte auch sagen: auf raffiniertere, eben auf »französische« Weise. Denn die hier erwählten und installierten Autoritäten sind Jacques Lacan (dessen Fehlbezeichnung des sogenannten Borromäischen Knotens wiederum mit weiteren Fehldeutungen überdeckt wird), Maurice Merleau-Ponty (der Gewährsmann für den »Leib«) und Michel Foucault (der hartnäckige Beschreiber), auf die auch die erwähnte Begriffsakrobatik zurückgeht, die im Glücksfall nicht nur Verwirrung stiftet – sondern auch Anstoß zum Staunen, Sehen und Formulieren.
Von den Abhandlungen dieses Buchs greife ich nur ein paar heraus, die mich rein »persönlich« interessieren, beinahe könnte ich auch sagen: rein körperlich.
Zunächst den Beitrag »Televisierte Körper« von Knut Ebeling, der von einer menschlichen Eigenheit namens »Starkult« berichtet, welche Benennung die Verehrung bestimmter sogenannter Prominenter begrifflich mit der Verehrung der Himmelskörper überblendet. Beide quasi-religiöse Beziehungen setzen so etwas wie Fern-Wahrnehmung voraus – und Ebeling nennt denn auch seinen Beitrag dementsprechend.
Im Jahre 1946 fertigte der Ex-Propagandafilmer François Campaux ein zwanzigminütiges Künstlerporträt des Malers Henri Matisse an, das dann 1952 von Merleau-Ponty und 1964 von Lacan gesehen und kommentiert worden ist. Der Zeitlupenfilm zeigt die tanzende Gestik des malenden Körpers, die nicht nur vom Bewusstsein des Malers geführt, sondern »ferngesteuert« sei.
Und dann schildert Ebeling zwei Fernsehaufzeichnungen, die von Lacan, dem sprechenden, in den Jahren 1972 und 1974 gemacht worden sind. Beide sind von störenden Vorfällen heimgesucht worden, die Lacans Redekunst auch körperlich heraus- und hinaufgefordert haben, womit überdeutlich geworden ist, dass Reden in jedem Fall als eine körperliche Tätigkeit gelten muss – was der manieristische Lacan auch noch übertreibend auf die Spitze getrieben hat.
Ein Themenfaden, der manche Beiträge durchzieht, betrifft die Polarität zwischen »natürlich« und »künstlich« – auch wenn diese altmodische Terminologie eher vermieden wird.
Stefan Kristensen und August Ruhs nähern sich der Problematik mit ihren Beiträgen über »wilde« und »verzierte« Körper aus ethnologischer und psychoanalytischer Perspektive. Der »wilde« Körper ist ein Grenzphänomen, der entweder außerhalb oder vor jedweder Ordnung gedacht wird, oder er stellt eine andere, noch unbekannte Ordnung dar, die sich der geltenden Ordnung entgegensetzt und eventuell eine andere Ordnung anregen kann. Dies setzt einen Machtkampf voraus, den der wilde Körper nur gewinnen kann, wenn ihm affektive und soziale, also seelische und mehrkörperige Ressourcen zuwachsen, womit seine Wildheit auch schon relativiert wird.
Zunächst könnte man vermuten, dass der »verzierte« Körper, der ornamental modifizierte, sich dem »wilden« entgegensetzt, der eben erwähnt worden ist. Doch mit dem war ein Körper gemeint, der keinerlei menschliche Kultivierung erfahren hat. Hingegen sind die »Wilden« im ethnologischen Sinn solche Menschen, die ihre Absetzung etwa von den Tieren damit kenntlich machen zu müssen scheinen, dass sie ihre Körper mit kulturell codierten Bezeichnungen versehen.
In der Südsee sind bestimmte Hautbemalungen der Einheimischen den Europäern, die im sogenannten Zivilisationsprozess derartige Markierungen längst abgelegt hatten, wiederum als auffällige Körpermodifikationen bekannt geworden und entweder als Verfemungszeichen oder als interessante Exotismen gewertet worden. Gerade im frühen 21. Jahrhundert greift die Tätowierung auch in Europa als Stilmittel einer liberalen Körperästhetisierung und ‑sexualisierung wieder um sich.
Käte Meyer-Drawe greift in ihrem Beitrag »Schöne Körper« auf die traditionelle – etwa auch platonische – Qualitätsbezeichnung zurück und damit kann sie zeigen, dass die disruptiven Epochalisierungen, die der sogenannten Moderne (oder Postmoderne) eine »ganz andere« Realität, folglich auch ganz andere Idealvorstellungen oktroyieren, nur begrenzt gültig sind. Zwar formuliert sie eine scharfe Kritik an Schönheitsidealen, deren Durchsetzung man sich von der Schönheitsindustrie erwartet, aber sie verschweigt auch nicht, dass jedenfalls seit der griechischen Antike die Maler und Bildhauer (die im übrigen auch die Götter immer wieder neu gestalteten) die Sehnsucht nach Menschenschönheit ständig neu komponiert und projektiert haben.
Elisabeth Schäfer legt ihren Aufsatz über »Anziehende Körper« als Zitaten-Collage an und beginnt mit der Vermutung, alle Körper (nämlich Menschenkörper) könnten so etwas sein wie Pulsare, also Neutronensterne, welche das Endstadium in der Sternentwicklung eines massereichen Sterns sind. »Sie wären dann zugleich angezogene Körper, so wie sie auch immer schon anziehend wären – für andere Körper, für Materielles und für Intelligibles.« Die Anziehung darf aber nicht so stark sein, dass die Körper zusammenfallen: die Koinzidenz würde die Existenz der Körper aufheben, welche ja im Unterschied begründet liegt (welche Begründung Jean-Luc Nancy zufolge etwas Abgründiges hat). Diese Perspektive ermögliche es, das Ästhetische und das Politische als Geschehen in einem Zwischen zu denken.
Luce Irigaray beruft sich auf den Körperteil oder die Körperteile namens »Lippen«, die im Zusammenspiel von Konvex und Konkav, Selbst- und Fremdberührung immer wieder etwas produzieren, konsumieren, realisieren und transformieren können.
Elisabeth Schäfer erwähnt Beatriz/Paul Preciado mit der Zusammenbastelei vieler seit jeher bekannter Körperteile und Körpertechniken mitsamt dem Schreiben und Sprechen – unter dem Titel der »Pharmapornographie«. Preciado hat auch darauf hingewiesen, dass Spinoza betont, alle Körper würden in gewissen Eigenschaften übereinstimmen – so in der »potentia gaudendi«. Manche tun sich auch in diesen Belangen hervor, und das sei ihnen gedankt. Preciado bezeichnet die Prostituierten als Elite unter den anziehenden Körpern – sie bilden da nur eine Sorte.
Heidi Wilm kommt das Verdienst zu, mit den »Prägnanten Körpern« auch den Begriff der Gestalt wieder ins Gespräch zu bringen, der im ganzen 19. Jahrhundert eine große Rolle gespielt hat und dann um die Jahrhundertwende in mehreren Wissenschaften fruchtbar geworden ist – so in der Wahrnehmungstheorie. Ernst Cassirer und Helmuth Plessner haben den Begriff der Prägnanz philosophisch weiterverwendet. Merleau-Ponty hat ihm sein volles Profil verliehen, indem er, auf die ursprüngliche Bedeutung zurückgreifend, Nancys karge Identifizierung von Körper und Unterschied anreichert und gleichzeitig dementiert: denn der schwangere Körper ist eine Quasi-Koinzidenz von zwei Körpern und deshalb ein Ausnahmezustand, der nur ein paar Monate andauern kann bzw. muss bzw. soll.
Der Mutterleib, den auch Michel Foucault als »Ort der Herkunft« bezeichnet hat, ist für Merleau-Ponty jedoch nicht der einzige Fall einer körperlichen Prägnanz, die Zukunft enthält und hervorbringt.
Neben dieser futurischen Potenzialität ist den prägnanten Körpern eine besonders starke Deutlichkeit eigen, eine besondere Erscheinungsintensität oder -freudigkeit: Sie zeigen sich offensichtlich, und sie zeigen sich so, wie sie sind, sie sind monstrativ, ostentativ, vielleicht sogar aufdringlich und auffällig. Erscheinungsintensität, immanente Medialität, immanente Bildhaftigkeit – die natürlich auch durch externe Bildarbeit induziert oder gesteigert werden kann.
Das Model und der Montblanc erweisen sich in diesem Sinn als »prägnante Körper« par excellence.
Und ebenso das vorliegende Körperglossar.
