Marianne höre ich immer noch lachen.[1]
Marianne Schuller liest Ende 2015 Kafka als »großen Lacher« aus einem Brief an Felice heraus,[2] publiziert in der Zeitschrift RISS über das Lachen, Überschrift: Ein »großer Lacher« [Punkt] Kafka. Kafka an zweiter Stelle nach einem Punkt.
Als Redakteur der Zeitschrift hatte ich Marianne um einen Text zum Lachen gefragt. Sie quittierte das mit einem Lachen. Es wurde nicht ganz überraschend ein Text zu Kafka. Zu. Nicht Über. Zu Kafka mittels eines Briefs an Felice. – In der Briefsammlung geht es über 60 Mal ums Lachen. – Marianne las den Brief, wie an sich selbst adressiert. Sie lachte mit dem »großen Lacher«.
Mariannes Texte sind Zeugnisse der Suche nach einer Annäherung an die Einzigartigkeit der Autorinnen und Autoren durch die allen gemeinsame Schrift. Sie suchte nach deren Stimme, nach dem Überschuss, der nicht geradewegs zu lesen ist. Sie lieh, genau hörend, dem Seltsamen die Artikulationskraft ihrer eigenen Stimme. Das geht am besten, wenn es sein muss. Ihr Schreiben, aber auch ihr Sprechen war ein Gefäß und dann ein Verstärker für den nicht Form gewordenen Überfluss. Ausdruck davon war das unmittelbar keine Bedeutung transportierende Lachen. Ihre listige Kraft, geschult durch die ständige Arbeit am Unpassenden, Lustigen, Witzigen, auch dem Verletzenden, an Missverständnissen. Sie widmete sich mit Vergnügen dem Kleinem, Verrückten, den Flecken. Dem Über-Ich schlug sie Schnippchen, das Lehren war Elixier. Lächeln und Lachen wurden zu Widerstand und Abwehr. Sie raute versiegelte, selbstverständliche Lesbarkeit auf. Die Texte, einmal porös, gaben etwas vom Überschüssigen, nicht durch Buchstabenreihen Eingefangenen der Autorinnen und Autoren frei. Andersherum wurden Texte dadurch empfänglich für das, was drängte; als Leserin tat sie etwas hinzu; in den Texten konnte sie etwas niedergelegen, z.B. das überschüssig destruktiv Aggressive des »großen Lachers«.
Kafka schrieb an Felice: »Ich kann auch lachen, Felice, zweifle nicht daran, ich bin sogar als großer Lacher bekannt, doch war ich in dieser Hinsicht früher viel närrischer als jetzt.«[3]
Bei der Lektüre, so unterstelle ich Marianne Schuller, passierte wohl zweierlei: Auf der Ebene des Ausgesagten (énoncé), weist Kafka darauf hin, ruft in Erinnerung, dass er auch oder auch er lachen kann. In den Sätzen davor liegt das nicht nahe: »Deute mein Nichtantworten nicht schlecht, nicht zu meinen Ungunsten, diese Wellen, die mich tragen, sind dunkles, trübes, schweres Wasser, ich komme auch vorwärts und bleibe auch stecken, aber dann treibt es mich doch wieder weiter und es geht ganz gut. Du mußt es doch schon bemerkt haben in unserem ersten Vierteljahr.«[4]
Und auf der Grenze zum Aussagen, der énonciation, der, so könnte man lesen, fast verzweifelte Ausbruch: »Ich kann auch lachen, Felice […]«, was fast wie eine Drohung gelesen werden kann.
Marianne Schuller liest ein Luftholen, ein Aufatmen, ja, er kann auch lachen, so wie sie selbst auch! Sie sagt es mit Kafka von sich.
Symptom
Der Lacher im Brief, Thema des Beitrags zum RISS, wird zum artifiziellen Symptom für das, was mich als Leser von Mariannes Text und durch sie vermittelt als Leser von Kafka mit beiden verbindet: Kafka linear historisch weit weg, punktuell beim Lesen präsent, Marianne über fast vier Jahrzehnte mit ihrer Stimme, ihrem Lachen im Ohr und all dem, was wir gemeinsam auf den Weg gebracht haben.
Lalangue
Durch die Schrift des publizierten Briefes hindurch ist vom semantisch nicht Eingefangenen etwas wahrzunehmen von dem, was Lacan mit lalangue bezeichnet. Jenes Reale des Sprechens, das nicht klar und deutlich Ausgesagte, bietet erst den Spielraum für das Wirken des Gesagten. Das ist das, was immer wieder durchlüftet, begeistern kann. »Gute« Texte haben viel davon. Der Text und das Gesprochene werden zur Bühne für das Mitgesagte, das Singuläre. Lalangue wird dem Geschriebenen schräg abgelauscht, kann zu einer deutlicher schreib- und sprechbaren Kontur umgearbeitet werden betrieben von Lust und Not. Darin finden sich dann z.B. Spuren von Verletzungen, Narben, Genüssen der Sorte, die an die Substanz gehen. Marianne führte in Texte, in Gespräche eine Sonde aus mitgeschleppt Unausgesprochenem, mit reichem Erfahrungsschatz und hohem Auflösungsvermögen ein. Das ist eine Form psychoanalytischer Praxis, die mit dem Realen in Berührung kommt, das weder greifbar noch sichtbar, dennoch virulent ist.
Kafka hat Marianne Schuller immer mal laut gelesen [wer wen? – Genau das ist die Frage!]. Dabei sprang auch das Komödiantische aus der Schriftform hervor. Es treibt sich zwischen und hinter den Buchstaben herum, das Lachen Kafkas als vorgestelltes Laut- und Genussgebilde.
Marianne Schullers Art des Abhörens bediente sich nicht des Stethoskops, sondern der erogenen Zonen von Auge und Ohr, geschärft durch die eigene Stimme. Mit ihrer Stimme verlieh sie Kafka Gehör. Sie tat so, als lese sie Kafkas Text, als ob sie ihn von Kafka hörte.
Kafka kannte diese Haltung des »als ob«: »Nun ist es da, es ist wie [meine Hervorherbung, kjp] von jemandem geschrieben, der in Dich verliebt ist,« schreibt Kafka am 1. Juli 1913 an Felice über einen Brief seiner Mutter an Felices Vater, »ein grausliches wie urkomisches Elaborat. Wir werden noch darüber lachen.«[5]
Am Rande: Besonders vergnüglich war Mariannes Vorlesen von Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse.
Lachen
Beim Lachen in Textform wird deutlich, dass es, da es semantisch unterbestimmt ist, vieler Zutaten des Lesers bedarf, um die Unschärfe, den Überfall durchs Lachen mit viel Einfallsreichtum in eine schillernde Kombination aus Imagination und Artikulation für Hörer und Leser des interpretierenden Textes vernehmbar zu machen.
Membran: Überdruck und Unterdruck
Marianne Schuller gab von Erzählungen oder Briefen etwas wieder, das über die Textform hinausgreift. Vermutlich vernahm sie etwas, das den Text hat entstehen lassen. Sie erzeugte Resonanz bei anderen, schaffte sich selbst auch Resonanz mit dem Text als Schirm. Sie hat die Buchstaben und ihre Folgen durch Intonation zu Membranen gemacht, die gleichsam etwas von dem begehrenden Überdruck der Leserin selbst aufsaugen. Die Buchstaben fungieren als durchlässige Trennwand zwischen Autor, in dem Fall Kafka, und Leserin, hier Marianne Schuller. Über Zeiten hinweg schaffen sie paradox Nähe.
Auf der Leserinnenseite herrscht zugleich Unterdruck: Neugier, unabschließbares Wünschen. Permeabel werden die Membranen im Angstdruck; Begehren schützt davor, in Ängsten unterzugehen. Anders: Angstlust durchlöchert die Phalanx des gegeben erscheinenden Textes – Auslegung ist kein sanftes Unternehmen. Lachen als Instrument schnellen Öffnens und Verschließens, wird auch Symptom der aggressiven Momente des Produktionsprozesses. Es platzt durch nicht ganz dichte Zwischenräume heraus, drückt konventionelle Bedeutung zur Seite, öffnet angesteckte Zuhörerinnen und Zuhörer, konvulsiv.
Orgasmus
Stoßweises, mehrmalig hörbares und ansteckend konvulsives Entweichen lachhafter Laute überschreitet die Grenzen des Individuums, ein sexuelles Moment.[6] Im ansteckenden Lachen entsteht oft Vertrauen. Das fehlt den bakteriellen oder viralen Formen meist. Lachen wird zum invasiven Geschenk, ein Vertrauensvorschuss. Die Lacherin erhält sofort Autorität, wenn sie sie nicht schon hat, als Autorin. Das liegt daran, dass Lachen eine Befreiung von moralischen Schuldgefühlen ist, mit der Potenz, eingefahrene Denk- und Verhaltensweisen zu durchbrechen. Es befreit. Nicht weil die Schuld weg ist, sondern weil man mit ihr nicht mehr je individuell allein ist. Lachen, wenn es nicht im Keller stattfindet, eigentlich auch da, ist ein fait social, Anlass und Grundlage einer Komplizenschaft.
Kafkas Brief an Felice gibt dem Lachen Laut. Das Lachen drängt beim Lesen ins Hören, räumt den Zwang zur Seite, alles verstehen zu können und zu müssen und verlacht die etablierten Regeln, die Kafka im Brief schildert.
Die titelgebende Passage »Ich kann auch lachen, Felice, zweifle nicht daran, ich bin sogar als großer Lacher bekannt, […]«[7] ist ein Widerschein der Angst, verkannt zu werden, und zugleich Versuch, sich zu ermächtigen.
Marianne Schuller zeigt ihren Leserinnen und Lesern, wie bedrohlich das Lachen für die Lacherinnen, Lacher und die, über die gelacht wird, ist. Dass Marianne Schuller das überstanden hat, macht Mut.
Ein Lacher zu sein, ist mehrdeutig; kann heißen, immer wieder mal zu lachen, aber auch Objekt des Lachens zu werden, eine Witzfigur. Diese Lesemöglichkeit ist Marianne entgangen. Der Angst, eine Witzfigur zu sein, hat sie sich nicht gebeugt. Anderen bleibt sie in den Knochen, führt zur Eskamotierung von Risiken aus der Wissenschaft.
Komödiantin
Als Komödiantin suchte sie Gleichsinnende in der Literatur und mit Literatur und auch sonst. Die Komödie und ihre Lacher sind Fortsetzung praktizierter Religionskritik. Denn Lachen ist ein zunächst unspezifischer Moment der Enthemmung, ein Vorbote der Unverschämtheit,[8] Suspension der Scham. Scham verbirgt Wünsche, Fähigkeiten, kurz Macht.
So groß ist das Entsetzen, das sich des Menschen bei der Entdeckung des Bildes seiner Macht bemächtigt, dass er in seinem eigenen Handeln sich von ihm abwendet, sobald dieses Handeln ihm jenes Bild unverstellt zeigt.[9]
Entsetzen und Erschrecken können auflachen lassen, es kann plötzliche Suche nach Verbündeten sein, die den Mut haben, mit der Macht umzugehen,[10] eben die Mitlacher. Das plötzliche unwillkürliche Lachen verbündet im Verzicht, genau wissen zu wollen, was man bewirkt – was sowieso unmöglich ist.
Abhören
Abhören ist nicht Bestandteil der Profession einer ordentlichen Professorin der Literaturwissenschaft. Das Abhören von Texten war vielleicht ein Überlebsel (Freud) aus Mariannes anfänglichem Medizinstudium. Näherung im Hören an den Korpus von Texten ließ sie Symptome, Zufälligkeiten, Konfliktkonstellationen finden und gab den Texten die Chance, sie, als Leserin, zu finden.
Abhören ist Mittel der Überwachung und der Spionage, geheimdienstlichen Tätigkeit. Auch wenn voyeuristisches, zensierendes Zuhören nicht die Sache von Marianne Schuller war, so gab es doch diesen schelmischen, lächelnden Ausdruck des Ertapptwerdens, den Moment der Scham über ihre große Fähigkeit, auch Kleinstes wahrzunehmen.
Es war taktiles Hören, ganz nah. Manchmal ein schräges Danebenhören auf das Rauschen. Die von ihr laut oder leise vorgelesenen Texte bekamen raue Oberflächen. Aufgeraut durch etwas, das mit Rekurs auf die Verfilmung von Heinrich Spoerls Feuerzangenbowle (1933) als »Da stelle mer uns ma janz dumm«[11] sich bezeichnen ließe.
Methodisches
Ein anderer methodischer Vergleich wäre das Sternegucken: Neben den Stern sehen, den man erforschen will, gibt mehr preis von Konstellationen als direkt auf den Stern zu starren.
Man kann auch sagen: Marianne Schuller arbeitete den nach allgemeinen Regeln gedruckten Text Kafkas durch, als gehöre er zu einer mittelalterlichen Form der Literalität, in der Texte »die Körperbewegungen des Schreibenden ebenso wider[spiegeln] wie dessen Hörfehler und Ermüdungserscheinungen«, so Cornelia Epping-Jäger. Marianne Schuller arbeitet an Kafkas und anderen Texten immer wieder mit der Unterstellung, dass in ihnen wie »in den Manuskripten einer begrenzt literalen Kultur […] Kommunikation und Körperlichkeit noch nicht auseinander[treten]«.[12] Damals war die Schrift nicht von der Stimme und vom Akt des Schreibens abgelöst, sondern eingebunden in eine je aktuelle (Raum-) Zeitlichkeit.[13] Sie bewegt sich zwischen der Figur der empathetischen Leserin, die letztlich sich selbst gleich bleiben würde, und der Laut Gebenden für andere Lesende und erleidet eine Art Transsubstantiation.[14] Darin werden Autor (hier Franz Kafka in Textform) und Leserin (hier Marianne Schuller), beide stark verändert. Sie unterscheiden sich, aus beiden wurde etwas Anderes.
Marianne Schuller – so meine These – ging davon aus, dass, wie Paul Zumthor im Blick auf mittelalterliche Poesie schreibt, »unsere Texte nur eine leere und zweifellos zutiefst veränderte Form dessen [sind], was in einem anderen senso-motorischen Kontext einmal gewissermaßen ein volles Wort gewesen ist«.[15]
Ein bisschen regressiv ist Zumthor hier schon.
Macht und ihrer Suspension
Heraklit lag beim Schreiben dieses Textes von einem anderen Projekt auf meinem Schreibtisch: »Verbindungen: Ganzheiten und keine Ganzheiten, Zusammentretendes – Sichabsonderndes, Zusammenklingendes – Auseinanderklingendes; somit aus allem eins wie aus einem alles.«[16]
Aus den Vorsokratikern abgeschrieben ist das billig, gelebt aber teuer. Immerhin eine Utopie.
So empfehle ich nun meine Behauptung: Noch Früheres nahm Marianne Schuller mit dem Hören des Lachens und dem Lachen auf, Heraklit, der Gegensätze nach Maßstäben der späteren Logik bis zur Unerträglichkeit nutzt:
Lachen bildet für den Moment eine Art ausschließende Ganzheit so wie beim Schmerz: Es gibt kaum noch etwas anderes. Wie der Orgasmus, die jouissance, die körpergebunden Lust, nicht auf Dauer gestellt werden kann, hält die Ganzheit nicht. Beim sexuellen Akt gibt es eine Lust, die in der Schwebe bleibt: die des anderen.[17] Es gibt eine Äquivalenz von Angst und Orgasmus. Sie ist in der Klinik der Psychoanalyse, aber nicht nur dort – ebenso in der Art wie Marianne Schuller Literaturwissenschaft betrieb – lachend hörbar – ich übertreibe – als »die Möglichkeit der Hervorbringung eines Orgasmus auf dem Gipfel einer ängstigenden Situation, […] die eventuelle Erotisierung, wie man uns von überall her sagt, einer als solche gesuchte ängstigenden Situation«.[18]
Die gefürchtete und ersehnte Angst, bei Freud Angstlust, hat mit der an die Angst gebundenen Gewissheit zu tun, dem einzigen Affekt, der nicht trügt. Der Hiatus zwischen Körper und Seele tritt für eine Zeit ab. Lachen ist in der Hochspannung und allmählichen Entladung Lustprämie und jouissance in einem. Jouissance wird potentiell zum Lösungsmittel des besten und ekelhaftesten Klebstoffes, der Schuldgefühle. Das zu denken, ist in Anlehnung an Jacob Taubes eine widerstrebige Fügung. Lust, Freude, Auflösung, Selbstverbrauch, Angst, Begehren. Da kann mal was daneben gehen.
Wieso denn soll das Hören ein Fernsinn sein?
- Der Beitrag geht zurück auf einen Vortrag zur »Tagung zu Ehren von Prof. Dr. Marianne Schuller: Lesen und Schreiben. Figuren des Kleinen«, 3.–4.8.2024, Hochschule für Bildende Künste, Hamburg. ↩︎
- Marianne Schuller, Ein »großer Lacher«, Kafka, in RISS. Zeitschrift für Psychoanalyse, 83, 2016, 35–44. ↩︎
- Franz Kafka, Briefe an Felice Bauer und andere Korrespondenzen aus der Verlobungszeit, hg. v. Hans-Gerd Koch, Frankfurt a.M. 2015, Fischer, Brief vom 8.–9.1.1913, 162. ↩︎
- Ebd., 162. ↩︎
- Ebd., Brief vom 1.7.1913, 307. ↩︎
- Vgl. »Denn zumindest in der bürgerlich-patriarchalen Kultur war den Frauen das Lachen verboten. Drastisch sind diese Verbote etwa in den Benimm-Büchern des 19. Jahrhunderts ablesbar. Frauen dürfen lächeln, aber nicht lachen. Denn am Lachen sollt ihr sie erkennen. Wen? Die ordinären Frauen, die ihren sexuellen Körper ins Spiel bringen.« Marianne Schuller: Bunte Steine. Texte 1980–2023, hg. v. Iris Därmann, Günther Ortmann und Gunnar Schmidt, Weilerswist 2024, Velbrück, 29. ↩︎
- Kafka, Briefe an Felice, Brief vom 8.–9.1.1913, 162. ↩︎
- Davon handelt Umberto Eco, Der Name der Rose, München 1983, Hanser. ↩︎
- Jacques Lacan, Funktion und Feld des Sprechens und der Sprache in der Psychoanalyse, übers. v. Klaus Laermann, in ders., Schriften I, hg. v. Norbert Haas, Olten 1973, Walter, 71–171: 78. ↩︎
- Kafka sei nach Ansicht Elias Canettis ein »Experte der Macht« gewesen . Siehe Peter-André Alt, Der Ritt der Träume, in Philosophie Magazin, 2024, (5.4.2024), <https://www.philomag.de/artikel/der-ritt-der-traeume>, [letzter Aufruf am 27.10.2024]. ↩︎
- Die Feuerzangenbowle, 98 min., Regie: Helmut Weiss, Terra-Filmkunst, 1943/44. ↩︎
- Cornelia Epping-Jäger, Die Inszenierung der Schrift der Literalisierungsprozess und die Entstehungsgeschichte des Dramas, Stuttgart 1996, Metzler, 163. ↩︎
- Ebd., 163. ↩︎
- Ebd. ↩︎
- Paul Zumthor, Die Stimme und die Poesie in der mittelalterlichen Gesellschaft, übers. v. Klaus Thieme, München 1994, Fink, 60. ↩︎
- Die Vorsokratiker griech./dt., hg. und übers. v. Jaap Mansfeld, Stuttgart 1987, Reclam, 259, Fragment 46. ↩︎
- Vgl. Jacques Lacan, Séminaire 14. La logique du fantasme 1966/67, Sitzung vom 14.6.1967 <https://www.valas.fr/IMG/pdf/S14_LOGIQUE.pdf>, [letzter Aufruf am 27.10.2024]. ↩︎
- Jacques Lacan, Die Angst. Seminar X, hg. v. Jacques-Alain Miller, übers. v. Hans-Dieter Gondek, Wien 2010, Turia + Kant, 298. ↩︎
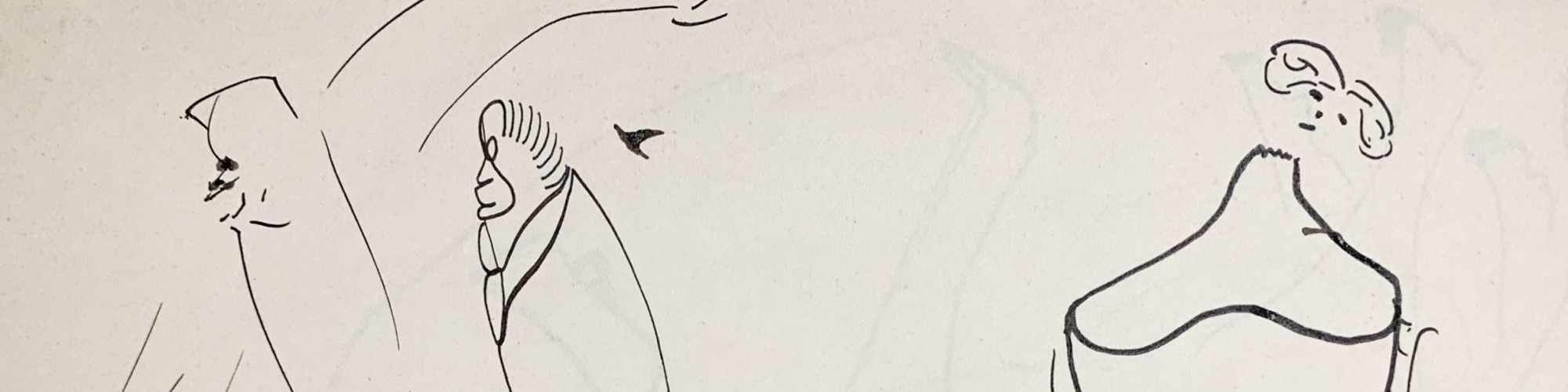
Schreiben Sie einen Kommentar